Diskurse in der Krise: Wege aus der Gelatine
Die soziale, die ökologische, die pandemische, die diskursive Krise – alle brauchen eine neue Ehrlichkeit. Denn die Sprache hat sich abgenutzt.
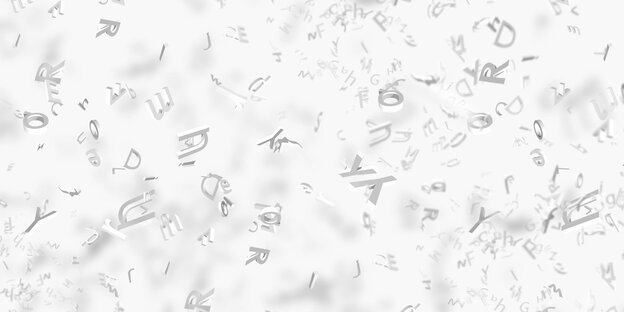
Buchstaben fliegen, Diskurse bleiben Foto: Sergey Nivens/imago
Neulich habe ich mich verliebt. Ich bin in meinem Insta-Feed an einem Foto der US-amerikanischen Künstlerin Lorraine O’Grady hängen geblieben. Das Foto verwies auf ein Interview des New York Times Style Magazine mit der 86-Jährigen. Ich verliebe mich schnell, wenn ich bei jemandem Antworten oder sehr gute Hinweise finde auf große Fragen, die mich beschäftigen. Oft finde ich so was bei Künstler:innen. Bei O’Grady fand ich die Sätze: „At a certain point, words just became gelatinous“ und „The only defense I can offer against the horrors of the outer world are new ways of thinking and seeing“.
Ich staune über diese Sätze. Mit dem ersten beschreibt O’Grady, wie sie während der Kubakrise als Geheimdienstanalystin für die US-Regierung arbeitete. Sie habe damals bis zu zehn internationale Zeitungen pro Tag lesen müssen – das ist viel, ich selbst schaffe kaum eine einzige. Dass mich die Gelatine werdenden Wörter so umtreiben, liegt an dem Bild wabbelnder Buchstaben. Und daran, dass „geleeartig“ den Jetztzustand sehr gut beschreibt.
Wörter funktionieren nicht mehr. Nach Jahren rhetorischer Wiederholung in politischer und medialer Kommunikation sind viele Wörter und Phrasen so was wie das Aspik um das Hähnchenfleisch und diese kleinen Fitzel saure Gurke geworden. So vieles glibbert sich zu einem großen weichen Klumpen zusammen, weil wir nach Worthülsen greifen, aus denen die Bedeutung, also das Rückgrat, längst herausgefallen ist.
Wenn man 100 Zäsuren behauptet, sind es dann überhaupt noch Zäsuren? Wenn man 100 Mal Normalität sagt, aber nie in Frage stellt, was Normalität bedeutet, wie viel ist dieses Wort wert? Sprache wiederholt sich, alles wiederholt sich und nutzt sich dabei ab. Vielleicht konnten wir nie so gut bei dieser Abnutzung zuschauen wie nach einem Jahr Pandemie.
Vielleicht hilft eine neue Rhetorik
Natürlich ist die Antwort auf das Gelatinierungsdilemma nicht die Erfindung neuer Wörter. Aber vielleicht hilft eine neue Rhetorik, die vorher ansetzt. „New ways of thinking and seeing“ bietet O’Grady an, als Antwort auf die Entsetzlichkeiten der Welt. Und ich bin verliebt und denke: Wenn nichts weitergeht, wenn alles gleichförmig geworden ist, dann kommen die besten Ideen für progressive Brüche aus der Kunst. Noch ein Grund, warum wir Künstler:innen in Krisen mehr brauchen denn je. Für unkonventionelle Wege aus der Gelatine.
Die soziale, die ökologische, die pandemische, die diskursive – alle Krisen brauchen eine neue Ehrlichkeit, neue Wege im Denken und Betrachten. Phrasen finden nur Kontur, wenn wir ihnen Kontur geben. Manche werden nicht zu retten sein. Aber wir könnten erzählen, was sie durchgemacht haben, und uns fragen lassen: „Wie meinst du das?“ Es trifft längst keinen Zeitgeist mehr, wenn mutige Ideen hinter verschlossenen Türen verworfen werden. Wenn wir uns immer weiter eingießen in dickflüssigen Kleber, kann sich irgendwann nichts mehr bewegen. Nur wabbeln, nicht wandeln.





