Gefängnisse in der Coronakrise: Eingesperrt und isoliert
Der Lockdown traf Inhaftierte in deutschen Justizvollzugsanstalten besonders hart. Droht jetzt die erneute Isolation?

Häftlinge leiden unter der Widersprüchlichkeiten bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen Foto: Imago
LUCKAU-DUBEN taz | An seinem 20. Hochzeitstag sitzt Maik Fried [Name geändert, d. Red.] alleine in seiner zehn Quadratmeter großen Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Luckau-Duben. Es ist Mitte April. Für Fried ist es ein besonders bitterer Tag. Vor 20 Jahren heiratete er seine Frau auf einem Segelboot in der Karibik. Jeden Hochzeitstag haben sie seitdem gemeinsam verbracht. Jedes Jahr schauten sie ihren Hochzeitsfilm, lachten darüber, wie sie sich auf dem schwankenden Deck des Schiffs durch ihren Eröffnungstanz kämpften. Dieses Jahr verbringen sie den Tag getrennt.
Zu diesem Zeitpunkt gilt in der JVA in Brandenburg schon seit über einem Monat ein absolutes Besuchsverbot. Bis Fried seine Frau wiedersehen darf, werden noch zwei weitere Monate vergehen. Und bis heute heißt es beim Besuch: Abstand, Trennscheibe, Maske und auf gar keinen Fall anfassen.
Die 2005 eröffnete JVA ist eines der modernsten und sichersten Gefängnisse Deutschlands. Fried sitzt hier in Haft, weil er eine große Menge Cannabis in seinem Auto schmuggelte. Er ist einer derjenigen, die durch den deutschlandweiten Lockdown der JVAs besonders viel verloren haben. Durch gute Führung hatte er sich für dieses Jahr Ausgänge erarbeitet, auch ein vierstündiger Besuch seiner Frau zum Hochzeitstag war bereits genehmigt. Durch die Coronapandemie fielen sie alle aus.
Zudem waren im Gefängnis zeitweise fast alle Angebote für die Gefangenen gestrichen. Gottesdienst, Drogentherapie und Schulunterricht fielen weg. Nur das Telefon auf dem Gang und Briefe blieben als Draht in die Außenwelt. Mitgefangene berichteten Fried, dass ihre kleinen Kinder sich kaum noch an sie erinnern konnten. Seit Ende Mai gibt es einen Anspruch auf zwei Stunden Videotelefonie im Monat.
Langeweile und Angst
Maik Fried, Ende fünfzig, stämmig, stahlblaue Augen, erzählt all dies Anfang September in einem spärlich eingerichteten Besuchsraum. Im Wandregal stehen Kinderbücher. Wo normalerweise Väter mit ihren Kindern spielen, trennen nun eine Plexiglasscheibe und mehrere Holztische Besucher von Insassen. Frieds Mimik ist unter seiner Maske kaum zu erkennen. Trotzdem merkt man ihm seine Empörung an. Immer wieder rutscht er auf seinem Stuhl herum.
„Depressiv-frustriert“ sei die Stimmung zu Beginn der Pandemie gewesen. Ein Großteil des Alltags sei plötzlich weggefallen, Langeweile mischte sich mit Angst. Trotzdem habe man Verständnis für die Maßnahmen gehabt, die zunehmend eskalierende Situation sei über die Fernseher gebannt verfolgt worden.
„Aber als dann der Lockerungstango losging, ist die Stimmung gekippt“, sagt Fried. Der Grund für den Unmut unter den Gefangenen: Während draußen schon wieder alles normal zu sein schien, blieb das Gefängnis noch bis in den Sommer im Lockdown. Der Frust ging so weit, dass Fried gemeinsam mit vier anderen Gefangenen bei seiner Abteilungsleitung mit einem Hungerstreik drohte.
Die größte Wut löst bei Fried die Inkonsistenz der Maßnahmen aus. Während Gefangene weder Ausgang noch Besuch bekamen, seien die Beamten unbekümmert und ohne Maske durch die Anstalt gelaufen. „Dabei sind sie doch die eigentliche Gefahr, können das Virus jederzeit von außen einschleppen.“
Bisher erfolgreich – aus epidemologischer Sicht
Dass es in Haftanstalten Widersprüchlichkeiten bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen gibt, bestätigen auch einige Anwälte. Den Gefängnisseelsorger Simeon Reininger aus Niedersachsen besorgt zudem die anhaltende Isolation. „Viele der Gefangenen kommen ohnehin aus sozial schwierigen Verhältnissen“, sagt er. Die Besuchseinschränkung mache es für sie noch schwerer, den sozialen Anschluss nicht zu verlieren.
Verantwortlich für die Sicherheit der rund 300 Gefangenen in Luckau-Duben ist Anstaltsleiter Hanns Christian Hoff. Der Psychologe trägt ein blaues Jacket und Sneaker. Er führt ohne Mund-Nasen-Schutz durch sein Gefängnis. Neben dem Besuchsverbot verordnete Hoff der Anstalt gleich zu Beginn der Pandemie ein strenges Clustersystem, teilte sie in vier Cluster. Alle Gefangenen eines Clusters wohnen, arbeiten und essen zusammen. Mitinsassen aus anderen begegnen sie nicht. So sollen Corona-Ausbrüche lokal begrenzt bleiben.
Einige Gefangene mussten für die Clusterbildung ihren Haftraum wechseln. Jene, die sich weigerten, verloren ihre Arbeit. Die vielen Einschränkungen belasten die Psyche der Gefangenen, das weiß auch Anstaltsleiter Hoff. Trotzdem gelte: „Einen Corona-Ausbruch zu verhindern hat Priorität.“
Bisher hat Hoff mit seiner Linie Erfolg. In der Anstalt gab es noch keinen einzigen Coronafall, was sicher auch mit lange niedrigen Zahlen in Brandenburg zusammenhing. Aber auch bundesweit hat sich die Sorge vor Corona-Massenausbrüchen in Gefängnissen nicht bewahrheitet. Erst 65 Gefangene und 167 Vollzugsbeamt*innen haben sich deutschlandweit bisher infiziert, die meisten davon in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Sorge vor der zweiten Welle
Ein Teil der Erklärung für den glimpflichen Verlauf der Pandemie in Gefängnissen: Die Justizministerien reagierten flexibel und scheuten nicht davor zurück, unbürokratisch Abhilfe zu leisten. So schufen fast alle Bundesländer freie Kapazitäten in ihren Gefängnissen, indem sie den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen temporär aussetzten. Die schon lange in der Kritik stehenden Strafen bringen jene hinter Gitter, die Geldstrafen nicht bezahlen.
Gefängniskritiker wie der Ex-Anstaltsleiter Thomas Galli sehen hierin auch eine Chance der Pandemie. „Die Erfahrungen aus der temporären Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafen sollten wir jetzt nutzen, um die Möglichkeiten auch für eine dauerhafte Abschaffung auszuloten“, sagt er.
Mittlerweile vollziehen die Justizministerien Ersatzfreiheitsstrafen wieder, externe Therapeut*innen arbeiten im Gefängnis, und auch Gottesdienste finden statt. Doch der Besuch bleibt eingeschränkt, Berührungen sind weiterhin tabu. Bis die Gefangenen wieder Nähe zu ihren Familien erfahren können, wird es angesichts steigender Infektionszahlen noch dauern. „Wie es langfristig weitergehen soll, weiß im Moment niemand“, sagt der Ex-Anstaltsleiter Thomas Galli.
Die Sorge, unvorbereitet in die zweite Welle zu laufen, teilt auch René Müller. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten warnt: „Wenn in einem Bundesland viele Bedienstete auf einmal ausfallen, wären wir schnell überfordert.“ Er regt für Notfälle einen bundesweiten Plan an, mit dem kurzfristig Bedienstete aus anderen Bundesländern zur Unterstützung herangezogen werden können. Bisher gibt es einen solchen Plan nicht.
Die steigenden Infektionszahlen besorgen auch Anstaltsleiter Hanns Christian Hoff. Er entscheidet gemeinsam mit dem Brandenburger Justizministerium und den anderen Anstaltsleitern in einer wöchentlichen Telefonkonferenz über erneute Einschränkungen. Derzeit seien noch keine Verschärfungen geplant, Brandenburg stehe von den Infektionszahlen her gut da. Die Entlassungsvorbereitung und Drogentherapien aussetzen zu müssen sei für ihn nur die allerletzte Option.
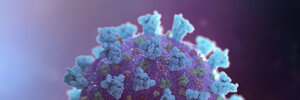



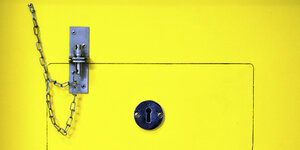





Leser*innenkommentare
Hampelstielz
Ich frage mich, was man mit den Inhaftierten erst alles machen würde, wenn wir es mit einer verheerenden Krankheit mit Letalität ähnlich der Pest zu tun hätten. Von wegen Humanismus. Der Anstaltsleiter, der in Artikel beschrieben wird, scheint das Letzte zu sein. Ein Herrscher eben.
Axel Berger
Ich bin gerade im Probeabo. Politisch stehe ich der TAZ eher diametral gegenüber, aber viele Artikel sind intelligenter als die gesamte übrige gelbe Presse zusammen. Jedenfalls meistens. Und dann das:
> die meisten davon in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Völlig egal, was das Thema und wovon gerade die Rede ist, der Satz stimmt immer. Die drei sind ganz einfach mit deutlichem Abstand die drei bevölkerungsreichsten Bundesländer. Das direkte Nebeneinanderstellen von absoluten Angaben aus vollkommen verschieden großen Grundgesamtheiten erwarte ich von Bild und Spiegel, deshalb lese ich den Unfug nicht. Hier hatte ich gehofft, von so viel Innumerik verschont zu werden. Zu früh gehofft, wie es scheint.
Andi S
@Axel Berger Hallo Herr Berger, nun sind Sie bei der taz. Die Mischung aus interessanten Themen und Perspektiven kombiniert mit einer gewissen Abneigung ggü. Bayern, BaWü und NRW (vielleicht weil man daher kam?) sind halt „Markenzeichen“.
Dreht sich halt viel um Hamburg und Berlin 😬