Sechs Monate Alltag mit Corona: Was neben dem Homeoffice bleibt
Camus lesen oder Brot backen? Ohne Katastrophenmanagment geht nichts. Die taz-Kulturredaktion über das Pandemieleben. Teil 1.

Wenigstens dem alten Laster kann die Pandemie nichts anhaben Foto: Cavan Images/imago
Ein halbes Jahr herrscht bei uns nun der Ausnahmezustand, und eigentlich ist alles wie zuvor auch. In meinem Leben jedenfalls: keine Clubs, keine Bars, am liebsten auf dem heimischen Sofa – vermissen tue ich trotz Corona kaum etwas.
Es mag zynisch klingen, doch mir kommt es so vor, als seien viele Sicherheitsmaßnahmen zu früh gelockert worden. Gut, während andere nach eineinhalb Monaten bereits auf dem Zahnfleisch liefen, hatte ich mich gerade mal an die Begebenheiten gewöhnt und geschafft, mir neue Strukturen zu schaffen. Ganz anders, als es Max Frisch einmal beschrieb, war der Krisenzustand für mich aber in keinster Weise produktiv.
Laut Frisch hätte ich dem Lockdown und was ihm folgte, den Beigeschmack der Katastrophe nehmen müssen, um etwas Ertragreiches zu schaffen. Daran bin ich erfolgreich gescheitert – mein inneres Katastrophenmanagement versagte kläglich. Die Pflichten zu erfüllen und nicht völlig eins zu werden mit meiner Jogginghose kostete mich derart viel Kraft, dass jeder Anflug von Kreativität dahinschmolz.
Sicher etwas neidisch, aber auch extrem genervt schaute ich anderen in den sozialen Medien bei ihren Missionen der Selbstverwirklichung zu. Camus lesen, Brot backen, dem Traumkörper entgegenstählen – mir schien, jede*r war in der Lage, die Coronakrise für sich in maximale Produktivität umzuwandeln. Natürlich kann auch ich abstrahieren, zwischen dem Glamour der Instagram-Welt und dem tatsächlichen Alltag, der gegen all die gefilterten Fotos und Storys profan wirkt.
Schöne neue Welt ohne Zugang
Plötzlich aber bekam man ja nichts mehr mit von all den Missgeschicken und Fehlschlägen, die sonst in Nebensätzen und Untertönen mitschwingen. Plötzlich fand alles nur mehr in diesem Internet statt und metamorphosierte sich in meinen Gedanken zu einer schönen neuen Welt, zu der mir aus unerfindlichen Gründen der Zugang verwehrt blieb.
Statt also die vermeintlich gewonnene Zeit für Klassiker im Buch- und Filmbereich zu nutzen, gestaltete ich, was neben dem Homeoffice an Freizeit blieb, extrem sinnlos. So sah ich meinen geliebten „Friends“ zum sicher 472. Mal beim Existieren zu. Das sind immerhin 236 Folgen à circa 25 Minuten verschenkte Lebenszeit. Verschenkt, weil ich bereits jede einzelne Sequenz sowieso schon mitsprechen konnte.
Extrem sinnlos, wenn nicht gar fahrlässig in Anbetracht eines die Atemwege befallenden Virus ist auch ein neues, altes Laster, dem ich seit der Pandemie wieder allzu beherzt fröne. Unnötig zu erwähnen, welches, hätte ich mir dafür definitiv einen passenderen Augenblick aussuchen können. Nämlich nie.
Über so viel Verantwortungslosigkeit kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln. Doch wie auch Coronaleugner*innen und Verschwörungsideolog*innen beweisen, bringt eine Ausnahmesituation wohl vor allem eines in den Menschen hervor: das Dümmste.
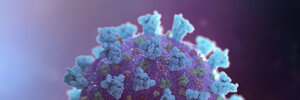









Leser*innenkommentare
Lowandorder
Ja wie? - “ bringt eine Ausnahmesituation wohl vor allem eines in den Menschen hervor: das Dümmste.“
&
Ehe ich ehna mit 'Selbstkritik' by Wilhelm Busch komme - wa.
Max Frisch? - mach Bosse & Seinse nachsichtig mit sich:
“Sein Leben lang sich mit Pubertät beschäftigen - is ja auch nicht so der Bringer!“ Gelle.
& vernichtend die Mutter:
“Max - hör auf über Frauen zu schreiben. Du verstehst sie nicht!“
kurz - Masel tov weiterhin -
unterm—— u.a. außen vor —
klar - Biedermann & die Brandstifter -
&
de.wikipedia.org/wiki/Fichenskandal
&
www.faz.net/aktuel...urde-14158976.html
& - 😱 -
www.tagesanzeiger....cia/story/21051959