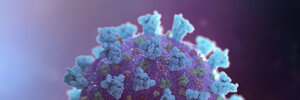Sechs Monate Alltag mit Corona: Schlendern mit traurigem Radarblick
Statt Expressivität macht sich in Berlin Affektkontrolle breit. Die taz-Kulturredaktion über das Pandemieleben. Teil 5.

Das wilde Leben, das war einmal. Abstandshalter in Berlin Foto: Tobias Seeliger/Snapshot/imago-images
Berlin-Schöneberg ist ein ziemlich vernünftiger Stadtteil. Das hedonistisch-antiautoritäre Erbe der Westberliner Jahre ist in die DNA der Kieze eingedrungen, in die Weinläden, die Bürger-Inis und Yogastudios. Queersein ist normal, Normalsein auch. Paare, die sich in Neukölln ausprobiert haben, ziehen – wenn sie eine Wohnung finden – hierher, um ihre Kinder großzuziehen. Es gibt eine selbstbewusste türkische Community. Und der Reichstag mag keine vier Kilometer entfernt sein, die Anti-Corona-Demos und Diktaturfantasien spielen doch in einem Paralleluniversum.
Vielleicht ist Schöneberg gerade deshalb ein guter Ort, um über die ersten sechs Monate mit Corona nachzudenken. Corona, das ist hier kein Ausnahmezustand mehr. Doch dafür kann man eben hier sehen, wie gründlich sich die Realität längst verschoben hat.
Zum Beispiel auf dem fußballplatzgroßen Kinderspielplatz am Lassenpark mit Dutzenden von Klettermöglichkeiten und sogar einer Märchenburg. Wer daran vorbeiläuft, hat ganz bestimmt den Eindruck, die Kinder würden inzwischen wieder wild durcheinandertoben.
Doch wenn man als beaufsichtigendes Elternteil daran teilnimmt, sieht man es anders. Zwischen den einzelnen Kleinfamilien herrscht ein kleiner, aber sorgfältig eingehaltener Abstand. In die Nestschaukel setzt niemand sein Kind, wenn da schon ein anderes sitzt. Es gibt Vierjährige, die Zweijährige ermahnen, ihnen auf der Rutsche nicht zu nahe zu kommen, „wegen Corona, weißt du“.
Anderes Beispiel: die niedrige Mauer, die das Rasenstück rund um die Apostel-Paulus-Kirche von der Akazienstraße abgrenzt. Man trifft sich jetzt halt nicht mehr zu Hause, sondern dort, bringt eine Flasche Chablis mit oder holt sich vom Späti gegenüber ein Bier. Man sieht Jugendliche, aber auch alte Freunde, Kolleginnen unter sich, Nachbarn. Solange das Wetter mitspielt, ist das alles ganz schön. Und auch da: kleine Gruppen, meist eh Zweierkonstellationen, und dazwischen sorgfältiger Abstand. Die Zeiten, in denen einem hier die Leute umstandslos auf die Pelle rückten, beim Schlangestehen, aber auch auf den Bürgersteigen, sie sind definitiv vorbei.
Wie bei Norbert Elias
Wenn ich jetzt hier durch die Straßen gehe, kommt mir vieles wie eine Illustration von Norbert Elias' „Prozess der Zivilisation“ vor. Berlin, das hatte, von Proll bis Boheme, ja immer etwas Expressives: vorgezeigte Selbstverwirklichung, hemdsärmelige Kommunikation. Da, wo ich wohne, herrscht aber inzwischen Abstand, Affektkontrolle, ein ständiger Radarblick, wo es eng werden könnte und man dann halt lieber nicht langgeht (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Das ist auszuhalten, ja, alternativlos auch, aber zwischendurch überfällt einen auch immer wieder der Gedanke, dass es traurig ist. Und vor allem auch erst einmal so bleiben wird, wer weiß, wie lange.
Der nächste Winter wird hart, denkt man. Und: Wann werden wir uns einmal wieder ausgelassen und entspannt begegnen? Das Leben ist enger geworden.