Allein unter Senioren während Corona: Zuhören, nicht selbst performen
Im Krankenhaus ist unsere Autorin mit Abstand die Jüngste. Auch sonst hat die Gesellschaft sehr viel älterer Menschen ihre Vorzüge.

Beste Gesellschaft im Krankenhaus: die Alten Foto: imago images
„Ich mag alte Menschen lieber als alle anderen Menschen. Sie sind schon irgendwie durch mit dem ganzen prätentiösen Teil des Lebens“, dringt es über Kopfhörer an mein Ohr. Die Stimme, die das sagt, gehört Sarah Kuttner, der Gedanke ihrem Hauptcharakter Jule aus dem Roman „180 Grad Meer“. 2015 ist er erschienen, für mich entdeckt habe ich ihn erst jetzt und auch nur als Hörbuch.
Zum Lesen habe ich gerade ohnehin nicht die Kraft, ich habe Schmerzen und liege auf einem höhenverstellbaren Krankenhausbett. Mit mir im Zimmer sowie in den umliegenden sind außer mir nur alte Menschen mit kaputten Handgelenken, Knien und Hüften, aber auch mit nicht mehr ganz funktionsfähigen Köpfen.
Einer von ihnen ist Herr U. – ich weiß seinen Namen nur, weil er auf einem selbst bemalten DIN-A4-Blatt an seiner Zimmertür klebt. Er ist schon etwas eingegangen, hat kaum mehr Haare, und seine Ohren stehen weit vom Kopf ab. Er erinnert mich an eine Mischung aus Nosferatu und Dobby, den Hauselfen aus den „Harry Potter“-Filmen. Sein Alter kann ich nicht schätzen, eigentlich wirkt er eher kindlich als greisenhaft.
Er ist noch mobil, äußerst sogar, denn gleich um welche Tageszeit, hört man ihn auf seinen Adiletten durch den Flur schlappen. Seiner Bettflucht folgt meist die Suche nach selbigem. Mehrmals täglich stapft er in unser Zimmer, fest davon überzeugt, es wäre seines. Weist man ihm den Weg zu seinem Zimmer, nickt er dankbar, nur um weniger Minuten später abermals umherzustreifen.
Friedlich schlafende Menschen
Sprechen tut er nicht viel. Nur einmal erfahre ich etwas, das mir einen Blick in ein, wie ich annehme, schon vergangenes Leben gewährt. „Heute habe ich kein Glück“, lässt er mich wissen. Er wolle doch eigentlich ins Jüdische Krankenhaus, seine Frau liege dort. „Aber da sind Sie gerade“, versuche ich zu erklären, ahne aber schon, dass es nicht die richtige Antwort ist. „Nicht wirklich“ – seiner Antwort folgt ein verschmitztes Lächeln, als wüsste er etwas, was mir und allen anderen entgangen ist.
Flaniert er nicht gerade durch die Station, macht Herr U. sich nützlich; sortiert herumstehende Rollstühle und Transportwägen, wischt das hölzerne Geländer mit einem violetten Staubtuch oder hilft bei der Essenausgabe. Nachts liegt er einmal in seinem Bett im Flur vor dem Schwesternzimmer. Unter Beobachtung, denke ich mir, denn ein ums andere Mal hat er bereits versucht, zum Rauchen auszubüxen.
Eigentlich will ich mir nur Ohrstöpsel gegen das Schnarchen meiner Zimmergenossin holen. Doch dann kann ich die Augen kaum von diesem friedlich schlafenden Menschen wenden. „[Alte Menschen] haben sich oft bereits abgefunden mit dem Jetzt, ihre Masken sind größtenteils schon abgebröckelt, darunter nur noch purer alter Mensch“, kommt mir ein weiterer Satz aus Kuttners Geschichte in den Sinn. Erst hier, in diesem Krankenhaus, fällt mir auf, wie beruhigend ich selbst die Gesellschaft alter Menschen finde.
Nicht performen müssen
Viele meiner Millennial-Freund*innen empfinden es als Zumutung, Zeit mit ihnen zu verbringen, selbst wenn es sich um die nächsten Verwandten handelt. Wie etwas Lästiges werden alljährliche Feiertagsbesuche ungeduldig und möglichst schnell abgearbeitet, Fragen der Älteren standardisiert beantwortet – so genau verstehen die ja ohnehin nicht, was man beruflich tut.
Für mich ist das anders; seit Monaten freue ich mich auf ein Wiedersehen mit Großeltern, -tanten, -onkeln. Seit Monaten ist da aber auch diese Sorge, die mich manchmal heimsucht und daran erinnert, wen diese Pandemie besonders gefährdet.
Was genieße ich eigentlich so an der Gesellschaft der viel Älteren? Vielleicht ist es genau das; in ihrer Gegenwart kann ich einfach nur zuhören, muss nicht performen oder Eindruck schinden. Oder um es mit Kuttner zu sagen: „[Alte Menschen] vermitteln einem nicht, dass man ihnen etwas schuldet, zu wenig ist.“
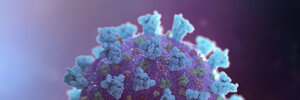









Leser*innenkommentare
mowgli
Zitat: „[Alte Menschen] vermitteln einem nicht, dass man ihnen etwas schuldet, zu wenig ist.“
Nun ja. Es gibt offenbar solche und solche Alte. Wenn ich mir dreißig Sekunden Zeit nehme, fallen mir bestimmt dreißig Ü-75-Leute ein, über die ich das Gegenteil behaupten möchte. Vielleicht sogar mehr. Nein, die liegen nicht alle im Krankenhaus. Die machen Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Kunst, Wissenschaft oder „was mit Medien“.