Präsidentschaftswahl in den USA: Biden ist ins Ziel gestolpert
Joe Biden wird im November gegen Donald Trump antreten. Genug Delegierte für die Nominierung hat er nun zusammenbekommen.

In der Bethel AME Church in Wilmington spricht Präsidentschaftskandidat Joe Biden zu Gläubigen Foto: Andrew Harnik/AP
Dies war der Moment, in dem Joe Biden sich beweisen musste. Die richtigen Worte finden, nicht stottern, alle flotten Sprüche vermeiden: In einer traditionell schwarzen Kirche in seinem Heimatort Wilmington, Delaware, stand er Anfang der Woche vor schwarzen Gemeindemitgliedern und sprach über George Floyd.
„Ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen“, zitierte er die letzten Worte des von Polizisten erstickten Afroamerikaners. „Diese Worte sind nicht mit ihm gestorben“, fuhr er fort. Er forderte eine Reform der Strafjustiz und sprach von der Macht der Worte: „Die Worte eines Präsidenten können sein Land in den Krieg führen oder Frieden stiften.“
Natürlich meinte er damit den amtierenden Präsidenten, den er im November ablösen will. In den wenigen öffentlichen Auftritten, die Joe Biden seit dem Ende der strikten Corona-Ausgangsbeschränkungen absolvieren konnte, zeichnete er eine tiefe Kluft zwischen der spalterischen Rhetorik und Strategie Trumps und dem Wunsch nach Versöhnung, den er verkörpere.
Um damit glaubhaft zu wirken, musste er auch eigene Fehltritte eingestehen, politische Entscheidungen früherer Jahrzehnte etwa, die dem Rassismus in den USA Vorschub leisteten, oder verbale Missgriffe wie die erst kürzlich gegenüber einem Schwarzen gemachte Aussage, wenn der ihn nicht wählen wolle, sei er „nicht schwarz“.
Meilenweit hinter dem Elan Obamas zurück
Joe Biden wird in den fünf Monaten bis zum Wahltag am 3. November noch viele ZweiflerInnen überzeugen müssen, dass er es verdient, mit dem höchsten Amt in den USA betraut zu werden. Der heute 77-jährige wäre nicht nur der älteste Präsident aller Zeiten, sondern sein Auftreten bleibt einfach meilenweit hinter dem Elan Barack Obamas zurück, dem er acht Jahre recht geräuschlos als Vize zur Seite stand.
Er muss die Delegierten beim Parteitag, die ihm im August formal die Kandidatur zusprechen werden, von den Stühlen holen. Er muss die progressive Basis der Partei, die lieber die politischen Vorstellungen seines Rivalen Bernie Sanders umgesetzt sähen, mobilisieren – nicht nur als WählerInnen, sondern als WahlkämpferInnen. Sie am 3. November dann tatsächlich in die Wahllokale zu bringen ist ebenso wichtig und ebenso schwierig wie die richtigen politischen Programmpunkte.
Bei den Vorwahlen hat dies zunächst nicht geklappt, da lag Sanders vorn. Erst in South Carolina, dem wichtigen Staat im Süden mit seiner großen afroamerikanischen Wählerbasis, fuhr Biden einen deutlichen Sieg ein. Nach weiteren Erfolgen am Super Tuesday dünnte sich die Schar der demokratischen BewerberInnen rasch aus, bis nur noch Sanders ihm Konkurrenz machte.
Nun, mit den Briefwahlstimmen bei den Vorwahlen in mehreren Bundesstaaten, ist Biden am Ziel und hat ohne große Fanfaren die absolute Mehrheit der Delegierten beim Parteitag hinter sich gebracht. Ob dieser zum üblichen Spektakel mit Luftballons, Feststimmung und großen Reden wird oder wegen der Corona-Beschränkungen zum blutleeren Video-Marathon auf unscharfen Zoom-Bildschirmen, ist noch nicht entschieden.


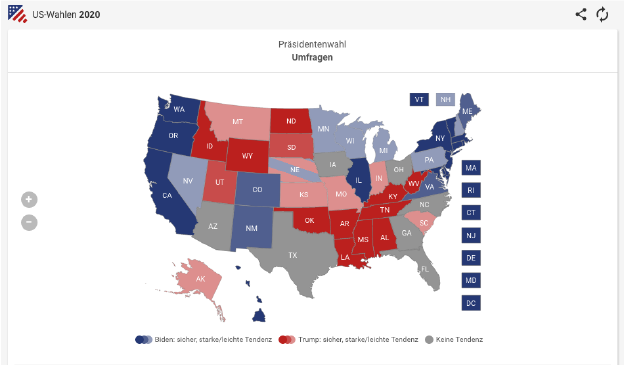



Leser*innenkommentare
joaquim
Ich würde mich feuen, wenn Trump abgewählt würde, woran ich noch zweifle. Aber ob der eventuelle Nachfolger Biden etwas wirklich verbessern würde, auch in Bezug auf Rassismus, mag ich bezweifeln. Eine oder vielleicht die einzige Chance, etwas wirklich zu ändern, wäre gewesen, Bernie Sanders aufzustellen, aber davor haben die eigenen Leute ja schiss. Na ja, Hoffnung stirbt als letztes, also gibt es vielleicht eine Frau Ocasio Cortes beim nächsten mal? Schön wäre es.
danny schneider
"Meilenweit hinter dem Elan Obamas zurück"
Was hat Obamas außer der Ausweitung des Drohnenkriegs den substanziell zu Stande bekommen? Eine halbgare Gesundheitsreform noch, OK. Aber im Prinzip hat er das Elend verwaltet und große Reden geschwungen.
Geleistet hat der Mann Nullkommanichts.
Nik...
Obamagirl Bradley oder die Frau von Herrn Präsident Trump oder Herrn PräsidentObama sind die Frauen, die die USA regieren können. Wer keine Frau nominiert, kann die nächsten Wahlen nicht gewinnen. Stellen beide Parteien eine Frau haben die USA die Aussicht, das Ansehen der USA wieder weit oben zu festigen. Die nächste Präsendentin muss eine Frau sein. Bei zwei weiblichen Kandidatinnen wird es ganz sicher so kommen. Ohne Zweifel waren beide Frauen, die von Trump und die von Obama die stärkste Intelligenz hinter dem Erfolg ihrer Parteien.