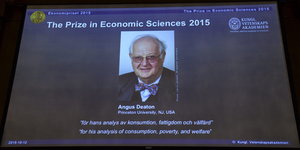Nobelpreis für Medizin: Der Kampf gegen Parasiten
Drei WissenschaftlerInnen teilen sich den Medizinnobelpreis. Sie haben Medikamente gegen armutsinduzierte Krankheiten entwickelt.

Die chinesische Professorin Tu Youyou (li.) mit einer Kollegin im Labor. Foto: China Academy of Chinese Medical/dpa
Mit der Verleihung des “Nobelpreises für Medizin und Physiologie“ hat das Komitee ein Zeichen gesetzt. Die drei ausgezeichneten WissenschaftlerInnen befassen sich mit der Bekämpfung von meist armutsinduzierten Krankheiten, für die sie wichtige Therapien entwickelt haben. Es handelt sich jeweils um Erkrankungen, die in den Industrienationen seit Langem keine Rolle mehr spielen. Während in der Ersten Welt Zivilisationsfolgeschäden wie Diabetes im Fokus stehen, sterben in den Tropen noch heute Hunderttausende an durch Parasiten übertragenen Krankheiten wie Malaria.
Der mit 850.000 Euro dotierte Preis geht zur Hälfte an Youyou Tu (84) und damit zum ersten Mal nach China. Die Pharmakologin Tu hat auf Basis des in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) gegen Fieber eingesetzten Krauts „Einjähriger Beifuß“ (Artemisia annua) ein wirksames Mittel gegen Malaria entwickelt. Sie bekam den Geheimauftrag für die Entwicklung des Medikaments 1967 von der chinesischen Regierung, die auf die vielen Malariafälle in Nordvietnam reagierte.
Von der Isolierung des Wirkstoffs Artemisinin in den 1970ern, den Tu zuerst an sich selbst testete, bis zum Einsatz eines Medikaments aus Artemisinin-Abkömmlingen vergingen rund 30 Jahre. Das Komitee betonte ausdrücklich, das nicht die TCM, sondern die Entwicklung eines neuen Medikaments mit einem umfassenden Nutzen für die Menschheit ausgezeichnet wurde. Tu ist erst die zwölfte Frau der 106 Ausgezeichneten in der Kategorie Medizin und Physiologie (1901–2015).
Die Nutzung tradierter Verfahren beziehungsweise der in ihnen angewendeten Wirkstoffe in der modernen Medizin bietet große Chancen. In den letzten Jahren wurden – wie etwa in Indien – Anstrengungen unternommen, solches Wissen unter eine Art Patentschutz zu stellen, um so zu verhindern, dass nur die großen Pharmakonzerne das Geschäft machen.
Seit dem Einsatz des Mittels ist die Anzahl der Malaria-Toten in den letzten Jahren um die Hälfte gesunken. Trotzdem sterben weltweit noch immer rund 500.000 Menschen an der Krankheit – mehr als die Hälfte davon Kinder. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt an, dass auch heute nur eines von fünf Kindern ausreichend mit Malaria-Medikamenten versorgt wird.
Der Ire William C. Campbell (85) und der Japaner Satoshi Mura (80) von der Universität Tokio teilen sich die zweite Hälfe des Nobelpreises für ihre Errungenschaften im Kampf gegen die Flussblindheit und das „Elefantenmensch-Syndrom“, die von Fadenwürmern übertragen werden. Campbell arbeitete, als er 1979 seine Entdeckung machte, für ein Forschungsinstitut des US-Pharmakonzerns MSD in den Vereinigten Staaten.
Er isolierte aus dem Bodenbakterium Streptomyces avermitilis den Stoff Avermectin. Mura, Mikrobiologe sowie Chemiker und Pharmakologe, sorgte im Labor des Kitasato-Instituts in Tokio für die Vermehrung lebender Bakterienkulturen.
Wikstoff gegen Fadenwürmer
Ivermectin, ein Abkömmling des Avermectin, wird seit den achtziger Jahren gegen Infektionen durch Fadenwürmer eingesetzt. Vor allem die durch Onchocerca volvulus ausgelöste und von Stechmücken, die an Fließgewässern wohnen, übertragene Flussblindheit, kann so bekämpft werden. Epidemiologen stellten fest, dass in Teilen Westafrikas in den 1970ern rund 60 Prozent der Bevölkerung an der Krankheit litten, von denen 10 Prozent bereits erblindet waren.
Das „Elefantenmensch-Syndrom“ ist eine Krankheit, bei der verschiedene Körperteile massiv anschwellen, was die Betroffenen in die soziale und berufliche Isolation treibt.
Armutsinduzierte Krankheiten wie Malaria, Flussblindheit oder Elefantiasis führen dazu, das Menschen auch fruchtbare Gebiete verlassen und so ganze Landstriche in Afrika veröden. In Südamerika ist die Lage hingegen deutlich besser: Heute ist Elefantiasis in Mexiko, Kolumbien und Ecuador ausgerottet. Bis 2020 will die WHO Flussblindheit und Elefantiasis weltweit besiegt haben.