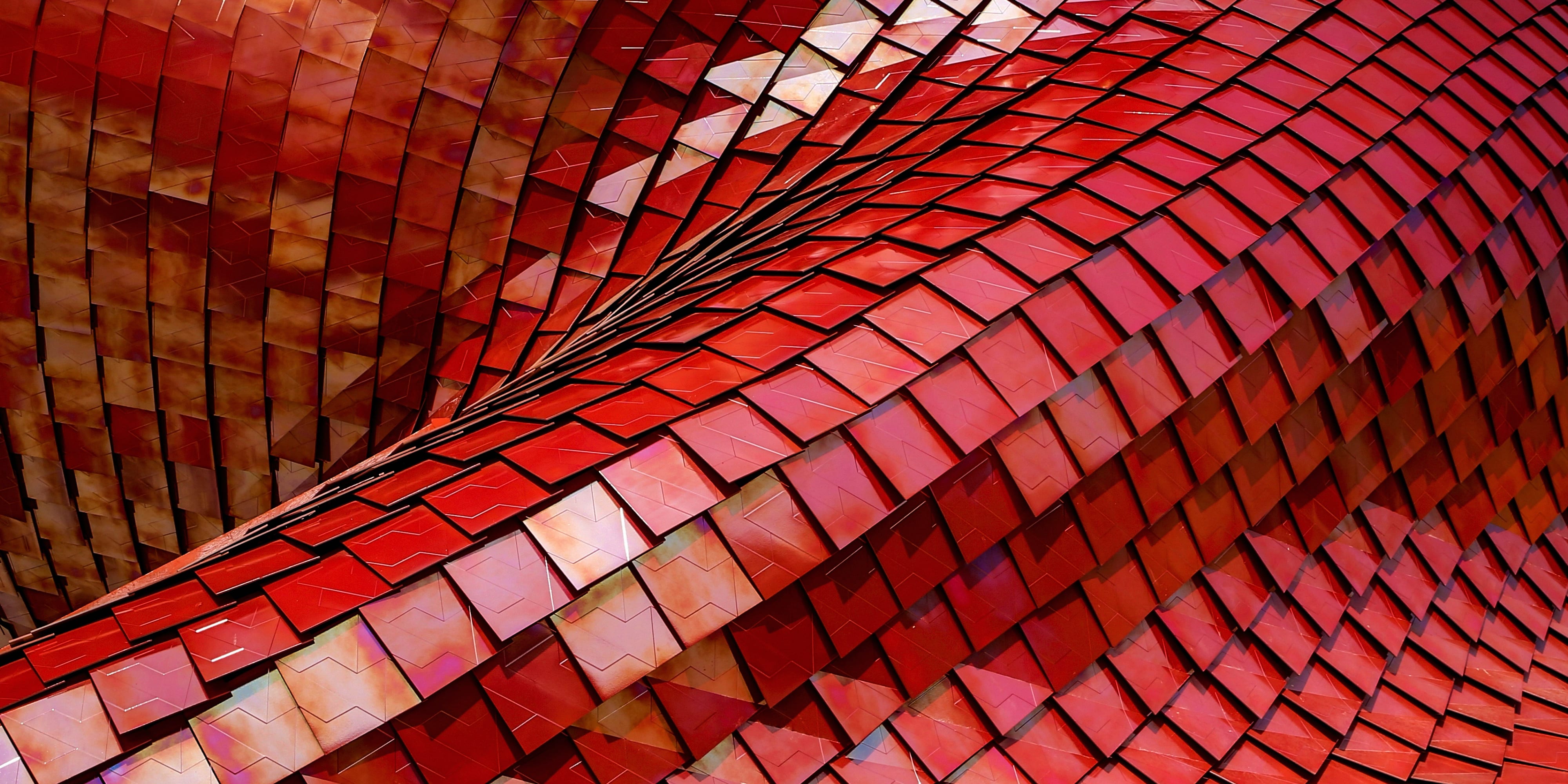Die 48er-Revolution ist blutig niedergeschlagen. Die Anführer sind standrechtlich exekutiert. Für Wien ändert sich manches.
Am 17. März 1849 vollzieht die Monarchie mit einem provisorischen Gemeindegesetz eine unitarische und uniforme Regelung des Kommunalwesens für das ganze Reich. Auch Wiens Statut als Reichshauptstadt basiert darauf. Die Gemeindeideologie dieses Gesetzeswerkes sieht in der Selbstverwaltung den Sinn, einen stufenförmig und doppelt geliederten, einheitlich organisierten Grossstaat zu errichten.
Man muss sich das so vorstellen: Die absoluten Herrschaft bildet eine Pyramide. Ihre Aussenseite wird gewissermassen von zwei Häuten überspannt: der äusseren der Zentralverwaltung und einer inneren, mit Orts-, Bezirks- und Kreisgemeinden. So nimmt die latent misstrauische Obrigkeit den Untertanen von zwei Seiten in Zange: als Gesamtstaat und als Heimatgemeinde.
Die partielle Dezentralisation sieht von aussen wie ein Gewinn für den Bürger aus. Doch in Wahrheit mildert sie bloss die ansonsten straff geführte Verwaltung, in der jeder Bahnhofsvorsteher einen Franz-Josephs-Bart trägt.
An strategischen Punkten der Stadt werden nun zitadellenartige Kasernenanlagen aufgetürmt: die Rossauer-Kaserne und die Franz-Josephs-Kaserne, die später, um die Jahrhundertwende dem Stubenring-Viertel weichen wird.
Überhaupt sitzt die Revolutionserfahrung dem Militär am schwersten im Genick. Die Feldmarschäle schwitzen und verlangen die Konzentration der verstreuten Artillerie-Etablissements. Man wählt dafür einen Platz im Süden der City, von dem aus sich die Südbahn, die Brucker Eisenbahn und der Neustädter Kanal, also die Stadt samt den Vororten unter dem Feuer einiger hundert Geschütze bestreichen lässt.
Es gibt Relais, es gibt Ausfallsstrassen, es gibt Knotenpunkte – die Herren Militärstrategen denken in den Begriffen des neuen Maschinenzeitalters. Vom einem grosser Gebäudekomplex mit festungsartigem Charakter soll die Belvedere-Linie, der Schwarzenberg’sche Garten, der 1848 eine üble Rolle gespielt hat, der Botanische Garten und die Kommunikation bis zum Glacis beherrscht werden. Geschosse sollen zum Stephansplatz und weiter fliegen, »zur Erhaltung der Ruhe« versteht sich.
Am 18. April 1849 bewilligt der Kaiser den Bau des Arsenals, wie das Artillerie-Etablissement vor der Marxer-Linie später genannt wird.
Die Kasernen drohen. Das heisst im Umkehrschluss, Kaiser Franz Josef kann sie nie mehr besonders sicher fühlen. Schon zwei Jahre später, 1850, glaubt er »den lieben Wienern« wieder einmal zeigen zu müssen, »dass es noch Truppen und Kanonen gebe« und, als das nicht gelingt, bedauert er öffentlich, dass »diese Leute zu pfiffig« sind, »um es zum Dreinschlagen kommen zu lassen«.
Wer sind »diese Leute«? – Ohne Frage sind unsere Vorfahren damit gemeint, die Stricker und Weber, Pferdeknechte und Erdarbeiter, der Beamten in den unbeheizten Kanzleien. Warum klaffen denn die Einschätzungen des Habsburgerstaates heute weiter auseinander als die anderer dynastischer Staaten? Etwa, weil sich der Östereicher von heute selbst nicht mehr versteht?
Für den Spätmonarchisten Alexander Randa fiel das merkwürdigste aller Reiche durch das gleiche Gesetz, nach welchem es einst angetreten: durch die Mission des Weltfriedens, und in dieser »seelischen Konsequenz« sah er sein wertvolles grosses Erbe: »Weder wollte es die Welt für Europa erobern noch sollte seine Weltmacht Europa erdrücken; hier ward ein einziges Mal der Versuch unternommen worden, Europa und die Welt in einem Glauben friedlich zu vereinen«.
Wer’s glaubt, wird seelig! Denn ist die eine Position, die liebliche. Die Sehnsucht nach einem verlorenene Ursprung, der Wunsch nach einer Regeneration durch Naivität.
Die Ehre den konträren Gegenstandpunkt zu vertreten, lasse ich heute dem vergessenen Schriftsteller Siegfried Flesch zufallen, der wie Ernst Bloch, Hugo Ball, u.a. im Ersten Weltkrieg in die Schweiz emigriert ist:
»Tiefer, bis in das finstere Mittelalter«, so Flesch, »muss man hinabsteigen, um die Basis aufzudecken, auf der sowohl ein Metternich, wie sein gelehriger Schüler Bismarck das Riesengebäude errichten konnten, das als Bollwerk der Verschwörung gegen den Fortschritt heute nur mittels Intrige und Fälschung noch aufrechtsteht. Ältester Hort jener mittelalterlichen Wachtordnung, die sich Gottesstaat nannte, und aus der jede politische Korruption der letzten Jahrhunderte hervorging, ist Österreich.«
Ich verhehle nicht, welchem dieser beiden Geschichtsbilder ich den Vorzug gebe, welches ich für geeigneter halte, um das kurze Leben auszunutzen und eine Legende zu zertreten.
Müssen wir die Monarchie erst noch »bewältigen«, wie es gerade mit der NS-Vergangenheit der Fall war? Es ist ja nicht alles stockfinster und pechschwarz an der Habsburgerepoche. Es gibt auch lichte Stellen. In den Jahrhunderen der feudalen Prachtentfaltung ist aus dem antiken Handelscamp am sumpfigen Donauufer eine Stadt mit anmutigen barocken und neoklassizistischen Schlössern und Palästen geworden, ein Wien, gekrönt von Metallkuppeln und vergoldeten Turmhelmen.
Aber ist andererseits diese Repräsentationsleistung, die heute kaufkräftige Touristen zu Massen ins Land lockt, schon ein Grund, in der Monarchie ein goldenes Zeitalter zu sehen?
Ich meine: Nein. – Die österreichische Geschichtswissenschaft schwelgt in Sachen Habsburger in einem populären Biographismus, der die Handelnden gerne von der menschlichen Seite zeigt. Zwar lassen sich inzwischen auch Bücher über die schrulligen Herrscher und die schwarzen Schafe der Kaiserfamilie finden, Werke über die Pleiten und Pannen der Grossen von Gestern. Doch selbst in der Polemik bleiben die Erörterungen dem vom Ausland willig apportierte k.u-k.-Kitsch verpflichtet.
Hitler und seine Pseudowissenschaft ist ein breit diskutiertes Thema geworden. Ganze Schulklassen zerbrechen sich regelmässig den Kopf, wie die Opfer seiner Politik im Stadtgedächtnis erhalten bleiben können.
Die Monarchie aber steht bis heute unter einem Glassturz. Der Sitz des berühmten vom Kaiser bewillgten Privilegienparlaments zum Beispiel – von den Wienern nach einem Ministerpräsidenten »Schmerlingtheater« genannt –, dieser Bau, für den man – O, Mutterland der Demokratie! – den altgriechischen Stil für passend hielt, wurde 1918 bis auf die klienste Schraube unverändert von den Republikanern übernommen.
Bis heute zieren die Sinnbilder der 17 Kronländer der Monarchie den Giebel über dem grossen Portal. Wie wär’s denn mal damit, das Versäumnisse von 1918 endlich nachzuholen und sie zu entfernen?
Vergangenheitsbewältigung ist im Zusammenhang mit der Monarchie in Österreich kein Thema.
Wiens Mitte ziert der Stephansdom mit seiner berühmten Turmspitze: darauf seit der letzten Bekrönung 1864 der monarchistische Doppeladler mit dem Doppelkreuz. – Ist es nicht erstaunlich, ja unglaublich, dass den seit 140 Jahren daran vorbeieilenden Demokraten und Demokratinnen noch nie ein würdigeres Symbol für die offene Gesellschaft, die sie geschaffen haben, eingefallen ist?
© Wolfgang Koch 2007
next: DO