„Unzumutbares Psychospiel“: Das Eltern-Lehrer-Gericht
Bei den Lernentwicklungsgesprächen geht es zu sehr um die Schwächen, kritisieren Eltern. Zu Zielvereinbarungen darf kein Kind gezwungen werden
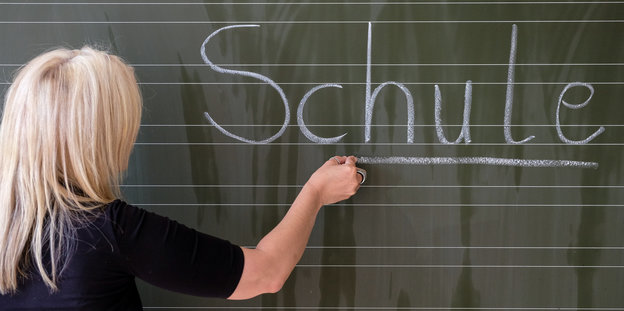
Die Lernentwicklungsgespräche für Schüler sind umstritten. Foto: Axel Heimken/dpa
HAMBURG taz | Vergangene Woche wurden in Hamburg wieder die jährlichen „Lernentwicklungsgespräche“ abgehalten, bei denen Lehrer und Kind im Beisein der Eltern über die Schule sprechen. Diese 2009 unter Schwarz-Grün eingeführte Neuerung, kurz LEG genannt, hat auch Kritiker. Nicht groß überraschend war es Schulreform-Gegner Walter Scheuerl, der zu Beginn der Woche klarstellte, dass es bei den Lernentwicklungsgeprächen „keinen Zwang zu Gehirnwäsche und Unterschriften von Kindern und Jugendlichen“ geben könne. Es hätten sich Eltern gemeldet, die die zum Ende eines LEG zu unterzeichnende Vereinbarung als „unzumutbares Psychospiel“ empfänden.
Den Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, kann das nicht erschüttern. „Verbindliche Ziel- und Leistungsvereinbarungen werden empfohlen“, erklärt er auf Nachfrage. Sie ermöglichten es, das volle Potenzial der Schüler zu entfalten.
Wissenschaftlich evaluiert wurden diese Vereinbarungen zwischen Kind und Schule nicht. Und nicht nur Walter Scheuerl, auch kritische Pädagogen wie Kurt Edler lehnen sie ab. „Wenn man ein Kind schriftlich zu etwas verpflichtet, ist es ein Vertrag“, sagt der frühere Grünen-Chef. Der Gesetzgeber habe aber gute Gründe, ein Kind nicht für vertragsfähig zu erklären. „Was ist denn, wenn sich der Eifer nicht entwickelt?“ Kinder in der Vorpubertät wollten alles richtig machen und betrachteten dies mit heiligem Ernst. „Für ein Kind ist eine Unterschrift etwas Unheimliches.“
Die taz sprach mit acht Eltern über ihre Erfahrungen, und alle finden die Sache „ambivalent“. Sein neunjähriger Sohn sei aufgeregt gewesen, berichtet ein Vater. Der Lehrer war nett und habe viele Stärken des Kindes aufgezählt. Eine Unterschrift war nicht nötig. Doch nun muss der Junge zu Hause einen Zettel ausfüllen: „1. Das kann ich schon gut, 2. Hier muss ich noch üben, 3. Das nehme ich mir fürs nächste Halbjahr vor.“ Eine Frage zu Stärken, zwei zu Schwächen.
Schwächen müssen vom Kind selbst benannt werden, in Gegenwart von Eltern und den Lehrern. Hier gebe es einen „Macht-Problematik“, hatte Edler schon vor zwei Jahren in einem Papier gewarnt. Es wundere ihn, dass den reformerischen Akteuren der Blick darauf verstellt sei. Für die Schüler gebe es kein Entrinnen. Sie müssten sich vor einem „freundlichen Erwachsenen-Gericht“ verantworten, statt mit dem Lehrer auch mal Geheimnisse zu haben.
Jaana Rasmussen sieht das ähnlich. „Ich fand die LEGs anfangs fortschrittlich, weil man die Kinder mit einbindet“, berichtet die Mutter. „In der Realität ist das so: Das Kind sitzt zwei Autoritätspersonen gegenüber.“ Das Kind habe keine Macht, keine Chance auf einen Dialog auf Augenhöhe. Der Lehrer gebe letztlich die Noten im Zeugnis.
„Selbstbezichtigungscharakter“
„Die Kinder mögen gar nicht reingehen in so ein Gespräch“, sagt Mutter Ulrike Dockhorn. Die Gespräche hätten „Selbstbezichtungscharakter“ und würden für schwächere Schüler zum Spießrutenlauf. „Die Mitsprache für Schüler ist im System Schule nicht angelegt“, sagt die Unternehmerin. „Sie können nicht über Inhalte bestimmen, sondern höchstens, wie schnell sie Zettel abarbeiten. Von daher ist ein Gespräch über scheinbar selbst gesteckte Lernziele manipulativ.“
„Weil das Ergebnis die Zielvereinbarungen sind, sind die Lehrer bemüht, etwas Negatives über das Kind zu finden, das dann verbesserungswürdig ist“, berichtet eine Mutter, die anonym bleiben möchte. Häufig werde deshalb 80 Prozent der Zeit über belanglose Schwächen gesprochen. Doch bei einem Mädchen, bei dem es nichts zu kritisieren gab, sei das Gespräch im Tribunal geendet. „Sie ist weinend zusammengebrochen.“
„Es gibt Gespräche, die werden so gut geführt, dass die Kinder wachsen“, berichtet die Elternvertreterin Sigrun Mast. „Es kommt darauf an, wie erfahren die Lehrer sind.“ Doch leider gebe es auch die, die schief laufen. „Die Lehrer und Kinder sind unter Druck, die Eltern hören zu“, beschreibt sie das Szenario. „Und das Kind denkt, dass die Eltern auf Seite der Lehrer sind.“ Der Druck zur Unterschrift tue dann sein Übriges.
Lernentwicklungsgespräche seien im Prinzip gut, sagt Michael Schulte-Markwort, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Eppendorf. „Auch bei uns auf der Station sind die Kinder bei den Übergaben dabei und hören, was wir sagen.“ Er sei aber gegen Verträge mit Kindern, sagt Schulte-Markwort. „Ich treffe Absprachen mit Kindern, aber das geschieht dann mündlich.“





