Neues Buch mit Foucaults Vorlesungen: Denken an einer Scharnierstelle
„Über den Willen zum Wissen“ versammelt Vorlesungen aus den Jahren 1970/71. Sie ermöglichen es, Michel Foucaults Denkprozess mitzuerleben.
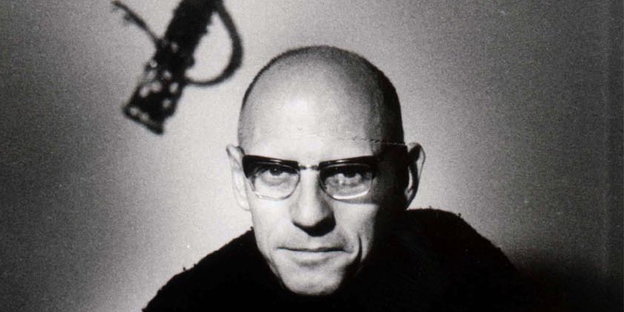
Michel Foucault. Bild: Archiv
Von Foucault gibt es zwei Bücher, die die „Wissensgier“, wie Nietzsche einst sagte, im Titel führen: „Der Wille zum Wissen“ aus dem Jahre 1976 und nun – aus dem Nachlass – ein Werk mit dem Titel „Über den Willen zum Wissen“. „Der Wille zum Wissen“, ein längst zum Klassiker gewordenes Werk, hatte seinerzeit die verbreitete These bestritten, dass die bürgerliche Gesellschaft „sexuell repressiv“ sei und systematisch Triebbefriedigung durch nützliche Arbeitsanstrengung ersetzen möchte.
Es gelte eher das Gegenteil: ein kapitalismuskonformes Machtdisposititiv, das von innen her Macht über unsere Körper ausüben möchte, generiere Diskurse, die zur unablässigen Beschäftigung mit den eigenen Lüsten und zu deren polymorphen Vervielfältigung anstachelten.
Das nun herausgekommene, fast titelgleiche Buch „Über den Willen zum Wissen“ publiziert die Vorlesungsfolge, die Foucault 1970/1971 am prestigeträchtigen Collège de France gehalten hatte. Der Stil ist spröder, als man es von dem brillanten Schriftsteller gewohnt ist: Der Herausgeber musste das Buch aus oft nur anformulierten Vorbereitungsnotizen zusammenstoppeln. Aber der Leser hat so die Gelegenheit, den Denkprozess Foucaults relativ direkt miterleben zu können.
Foucault befand sich damals an einer Scharnierstelle seiner Entwicklung: In den Vorlesungen nahm der Übergang von der strukturalistischen „Archäologie“ (die die immanenten wahrheitsbildenden Regeln von Diskursen untersucht) des „frühen Foucault“ zur „Genealogie“ seiner mittleren Phase Gestalt an. Es zeichnet sich ab, was dann zum Beispiel im „Wissen zum Willen“ entfaltet wird: dass Diskurse nicht einfach nur Wissen strukturieren, sondern dabei Machtpraktiken sind.
Philosophisches Kündigungsschreiben
Das Buch beginnt mit einer philosophiegeschichtlichen Erörterung, die eigentlich, zumindest wenn man Philosophie als „Liebe zur Weisheit“ versteht, so etwas wie ein Kündigungsschreiben an diese Disziplin ist. Erkenntnis von Wahrheit, so Foucault, werde nicht von Liebe, sondern eher von Bösartigkeit beflügelt.
Nicht Freiheit eröffnet ihr einen Raum, sondern Gewalt: die aggressive Unterwerfung der Erfahrungswelt und der spontanen eigenen Reaktionen. Die Geschichte der Wahrheit hat nichts mit Rationalisierungsfortschritt zu tun, sondern mit wechselnden Machtpraktiken, die sich ihre Diskurse schaffen.
Im weiteren Verlauf seiner Vorlesungen identifiziert Foucault die Genese des okzidentalen Wahrheitsdiskurses in sozialen Praktiken, die sich in der griechischen Gesellschaft des 7. und 6. vorchristlichen Jahrhunderts herausgebildet haben. Mit diesem Ausscheren zu historischen Studien bestätigt er einmal mehr, dass er, wie er einmal schön bemerkt hat, ein Denker sei, der sich „im Krebsgang, nämlich seitwärts bewege“.
Eine soziale Krise, so Foucaults These, habe zu justiz-, verfassungs- und sozialgeschichtlichen Transformationen und zu einer Reorganisation von Machtausübung geführt. Dabei habe sich die Konfiguration des Menschen zum „reinen“ Erkenntnissubjekt und die Auffassung von Wahrheit als Erkenntnis der Ordnung der Welt herausgebildet.
Es ist unverkennbar, dass Foucault die ältere Auffassung von Wahrheit, wie er sie in Homers Beschreibungen von Gerichtsprozessen vorfindet, erregender findet. Wahrheit war für die archaischen Krieger anders als für späteren zivilisierten Stadtstaatler kein „unter das Joch“ des Beweises gebrachter konstatierter Tatbestand, sondern ein „Ereignis“, das als strafender Blitz am Himmel aufleuchten konnte.
Die nackte Wahrheit
Indem in der vorplatonischen Welt bei Rechtshändeln noch nicht umsichtig untersucht, sondern beherzt geschworen wurde, war es das eigene Sein und nicht der Sachverhalt, dem die Aura des Nacktseins zugeteilt werden kann: Nicht die Wahrheit wurde durch die neutralen Zeugen „enthüllt“, sondern „in schutzloser Nacktheit“ setzte der den Schwur wagende Beschuldigte sich dem Risiko einer Reaktion der Götter aus.
Das Adjektiv „wahr“ sei kein Prädikat, das man auf das Wort „Wahrheit“ anwenden könne, ist die These, die Foucault in seiner „Morphologie des Willens zum Wissen“ vertritt. Man könnte freilich nachfragen: Wie verhält es sich mit dem Wahrheitswert dieser Aussage? Sollte sie die Wahrheit über die Wahrheit enthalten, dann gäbe es paradoxerweise zumindestens in diesem Falle so etwas wie eine wahre Wahrheit.
