Nachruf auf Marvin Minsky: Der Uropa künstlicher Intelligenz
Vom menschlichen Verstand hielt er nicht viel. Marvin Minsky brachte Maschinen das Lernen bei – und wurde zum Wegbereiter künstlicher Intelligenz.

Marvin Minsky in seinem Zuhause in Boston, April 2015. Foto: ap
„Marvin Lee Minsky, 88, verstarb am 24. Januar 2016 in Boston, Massachusetts an einer Hirnblutung“, heißt es im unterkühlten Nachruf des US-amerikanischen Magazins Wired. Es folgen die Namen der Eltern: Fannie Reiser und Henry Minsky, Ortsmarken seiner akademischen Karriere: Studium der Mathematik in Harvard, Doktor in Princeton, 1954; größte Leistungen: Gründer des MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory 1959, und wichtigste Publikation: Perceptrons.
Zuletzt: „Minsky überlebte seine Frau Gloria; drei Kinder, Margret, Julie und Henry Minsky“. Wenige Zeilen – das war’s. Nichts von Genie, Visionär, Wegbereiter. Keine Gefühle, prosaisch, lieblos – fabriziert von einem Bot.
Wired beauftragt als Autor für den Nachruf einen Textroboter der Firma Automated Insights, der aus Daten automatisiert Inhalt generiert – sachlich, kompakt, nutzwertig. Marvin Minsky hätte dieser Nachruf gefallen. Denn der freundlich kauzige Opa mit der riesigen Brille hielt den Unterschied zwischen Maschinen und Menschen nur für einen temporären. Nichts Grundlegendes. Eine Frage der Zeit, bis Computer so intelligent sein würden wie Menschen.
Intellekt – so lautet das heilige Axiom der Künstlichen-Intelligenz-Forscher, als deren Uropa Minsky gelten muss – entspringt keinem göttlichen Odem, keinem unergründlichen Schöpfungsakt, sondern ist prinzipiell erklärbar. Beschreiben lässt er sich in der Universalsprache der Mathematik. Intelligenz muss in dieser Perspektive künstlich herstellbar sein.
Die Erforschung der Künstlichen Intelligenz beginnt schon, bevor Marvin Minsky mit seinen Kollegen den Begriff bei einer Konferenz 1956 in Dartmouth prägt. 1943 entwickeln der Neurologe Warren McCulloch und der Mathematiker Walter Pitts die „McCulloch-Pitts-Zelle“. Die erste künstliche Nervenzelle, die Prinzipien ihres biologischen Vorbildes als mathematische Funktion nachbildete. Sie gingen davon aus, „dass jede berechenbare Funktion von einem Netzwerk von Neuronen berechnet werden kann“. Also nahezu alles, was real ist.
Eine Ratte namens „Snarc“
Der Psychologe Frank Rosenblatt baute wenig später ein ganzes Netzwerk, das als „Perceptrons“ berühmt werden sollte. Für all dies interessierte sich der junge Harvard-Student Marvin Minsky. Gemeinsam mit seinem Kommilitonen, dem Ingenieur Dean Edmonds, nahm er sich vor, ein künstliches Lebewesen zu erschaffen. Eine Ratte, genauer genommen ein künstliches neuronales Netzwerk, das das Verhalten einer Laborratte in einem Labyrinth simulieren sollte.
Smartphones lernen sprechen und Bilder erkennen, aber auch Drohnen Ziele erfassen und Roboter töten
Das Tier nannte er Snarc (“Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator“). Es bestand aus 40 Neuronen, betrieben von mechanischen Vakuumröhren, einem Motor und Teilen eines B-24-Bombers. Snarc interagierte mit seiner Labyrinth-Umwelt und konnte aus Reizen „lernen“. Minsky war nicht nur Informatiker, bevor es diesen Beruf überhaupt gab, er interessierte sich auch für Psychologie. Das Vorbild von Snarc waren die Tierversuche des Begründers des Behaviorismus, Burrhus Frederic Skinner, der in Harvard unterrichtete und der die berühmte „Skinner-Box“ erfand: einen Käfig mit einem Schalthebel, über den man Futter bekommen kann, und einer Lampe. Darin eine hungrige Ratte.
Skinner ging davon aus, dass sich Verhaltensweisen von Lebewesen erlernen lassen – durch Belohnung dieser Verhaltensweise. Mit diesem „Reinforcement Learning“ brachte er beispielsweise die Ratte dazu, den Hebel nur zu betätigen, wenn das Licht brannte, und Tauben dazu, eine Acht zu laufen.
Minsky faszinierte die Strenge von Skinners Methodik. Die „Skinner-Box“ isolierte das Versuchstier völlig von allen äußeren Reizen. So ließen sich Einflüsse exakt kontrollieren und kleinste Verhaltensweisen belohnen. Er hatte damit einen Automaten gebaut, mit dem er Tiere programmieren konnte. Minsky wendete die Methode Skinners auf seine künstlichen Laborratten an – mit Erfolg. „Mehrere Ratten interagierten auch miteinander. Wenn eine einen guten Weg fand, tendierten die anderen dazu, ihr zu folgen. Wir waren begeistert, wie aus so einem winzigen Nervensystem so komplexe Verhaltensmuster hervorgehen konnten“, so Minsky.
Finanziert wurde Snarc übrigens von der US-Luftwaffe, wie Minsky sorglos in einem Interview mitteilte. Auch die Erforschung und Entwicklung Künstlicher Intelligenz wurde von Beginn an vom Pentagon finanziert. So auch das 1962 gegründete Institut für Künstliche Intelligenz in Stanford und die Institute am MIT, an denen Minsky später lehren sollte. Der Weg militärischer Forschungsgelder für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz ließe sich bis in das Utah Data Center der NSA verfolgen. Heute sind künstliche neuronale Netze der heiße Scheiß.
Autos lernen sehen
Ironischerweise hatte gerade Marvin Minsky diesen Forschungszweig im wirren Geäst der Künstlichen-Intelligenz-Forschung in den Winterschlaf versetzt. In seinem Buch „Perceptrons“ skizzierte er künstliche neuronale Netze als Irrweg. Heute jedoch fließt in diesen Forschungsbereich mehr Geld als jemals zuvor. Künstliche neuronale Netze machen nicht nur Investoren im Silicon Valley glücklich. Weltweit pumpen Banken wie Goldman Sachs, Konzerne wie Toyota, Google, Facebook oder der chinesische Suchgigant Baidu Milliarden in deren Entwicklung.
Mathematische Funktionen können Informationen in Zahlen repräsentieren. Software, die die Funktion neuronaler Netze simuliert, lernt, aus Rohdaten neue Software zu generieren, die Menschen längst nicht mehr verstehen. So lernen Autos sehen und autonom fahren, Smartphones sprechen und Bilder erkennen, aber auch Drohnen Ziele erfassen und Roboter töten.
Künstliche neuronale Netze können die Inhalte von Videos sprachlich beschreiben, können „sagen“, was sie „sehen“ – und entwickeln sich mit exponentieller Rechenleistung (ein Smartphone ist heute schneller als Supercomputer der 1990er Jahre) immer weiter. In der Medizin setzen Firmen wie IBM künstliche neuronale Netze bereits ein, um Krankheiten zu diagnostizieren. Sie produzieren Forschungsergebnisse und Reden für Politiker.
Und so wie Minsky schon Snarc dazu brachte, aus den rückgekoppelten Informationen mit einem Belohnungsmechanismus neue Informationen zu gewinnen, die kein Mensch zuvor programmiert hatte – also: zu lernen –, tut dies heute das „Deep-Q-Network“. Ein künstliches neuronales Netz der Firma Deepmind, die Alphabet, dem Mutterkonzern von Google, gehört.
2015 gelang es dem System, in verschiedenen Atari-Spielen übermenschliche Fähigkeiten zu erlangen. Ohne jede Programmierung. Das System sah wie ein Mensch am Bildschirm zunächst nur einen Pixelnebel und lernte, diesen zu interpretieren, verstand eigenständig die Logik der Spiele und entwickelte Strategien, um sie zu gewinnen. Der Motor war auch hier eine „Belohnungsfunktion“. In diesem Fall eine reelle Zahl, auf deren Maximierung das System eingestellt war. „Reinforcement-Learning“ heißt dieser komplexeste Ansatz der Künstlichen-Intelligenz-Forschung auch heute noch. Systeme lernen völlig eigenständig – wie ein Kind. Marvin Minsky war erfreut.


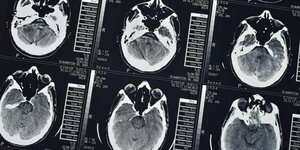

Leser*innenkommentare
Timelot
Ein Rechner der sich fragt: soll ich oder soll ich nicht, das ist hier die Gefahr.
Nicht ob ein Smartphone schneller als ein Supercomputer der 90er Jahre ist, was ich doch zu bezweifeln wage :) . Aber das Alphabet an KI arbeitet macht mir schon angst. Hawkins meint, ebenso wie Musk , das KI die größte Gefahr für die Menschheit überhaupt ist.
65572 (Profil gelöscht)
Gast
"KI die größte Gefahr für die Menschheit überhaupt ist."
Aus planetarer Sicht ist damit alles gut mit der KI.