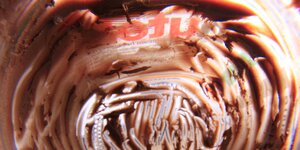Gerhard Falkners Roman „Apollokalypse“: Vertreter der Nutella-Generation
Falkners „Apollokalypse“ liefert ein wildes Sittenbild der 70er, 80er und 90er in Berlin. Es ist gut, es könnte auf der Shortlist des Buchpreises landen.

Hängt in Berlin ab: Schriftsteller Gerhard Falkner Foto: imago/gezett
Der Dichter, der nicht die Redeweise des Schicklichen nachahmt, um das Wahre und Gute darzustellen, hat im idealen Staat nichts zu suchen, glaubte Platon. Den Dichtern dürfe nicht gestattet werden, die Reden von Männern nachzuahmen, „die einander verleumden und verhöhnen und schmutzige Reden führen, trunken oder auch nüchtern. Kennenlernen müssen sie zwar Wahnsinnige und schlechte Männer und Frauen, selbst tun oder nachahmen aber nichts von diesen.“ Dass lässt Platon seinen Sokrates erklären.
Dass der Dichter auf die staatstragende Darstellung des Wahren und Schönen zugunsten einer wahrhaftigen Darstellung verzichten sollte, macht Gerhard Falkner gleich im ersten Satz von „Apollokalypse“ deutlich: „Wenn man verliebt ist und gut gefickt hat, verdoppelt die Welt ihre Anstrengung, in Erscheinung zu treten.“
Da fangen die Glocken an zu läuten, damit ist der Sound vorgegeben, der den Text über gut vierhundert Seiten zum Vibrieren bringen und den Leser hin und wieder auch in die Empörungsfalle tappen lassen wird, wenn ein Hähnchen penetriert oder über den üblen Geruch eines weiblichen Geschlechtsorgans berichtet wird. „Tabubrecherisch“, die herrschenden Sozialdemokraten und Protestanten ärgernd, wie man es von den bösen Buben der achtziger Jahre kennt, den Künstlern, Bohemiens und Taugenichtsen, die in diesem Roman ihr Unwesen treiben. Auch den PlatonikerInnen unserer Zeit wird womöglich einiges darin übel aufstoßen.
Vor wenigen Tagen hat der Lyriker Gerhard Falkner im Alter von 65 Jahren seinen ersten Roman vorgelegt. Er wurde gleich in die Longlist für den Preis des Deutschen Buchhandels aufgenommen. Zu Recht: „Apollokalypse“ ist ein kunstvoll gebauter Roman, der in seinen Beschreibungen der Leute, ihrer Redeweisen und ihrer Mentalität, aber auch in der Erzählweise und im Stil, in seiner Lust auf Verweise und Zitate selbst eine verschüttete Epoche wiederauferstehen lässt. Ein Roman, aus dem immer wieder Sätze wie jener am Anfang herausblitzen, die den Lyriker verraten: „Sogar der Himmel sah aus, als hätte man ihn im Neuen Deutschland gedruckt“, heißt es lakonisch über einen Besuch des Ich-Erzählers in Ostberlin.
Mit seinem grandiosen ersten Satz benennt der Autor die wesentlichen Topoi der Geschichte: In „Apollokalypse“ wird es erstens exzessiv um Liebe und explizit um Sex gehen; zweitens wird die Narration durch eine Verdoppelung des erzählenden Ichs vorangetrieben werden, das sich erinnernd selbst zu vergewissern sucht.
Mit Vorsprung auf die Welt gekommen
Georg Autenrieth heißt der Ich-Erzähler. Seinen Namen hat er von einem Mitschüler Falkners in der Grundschule geerbt, wie auch einige andere Figuren die Namen realer, semiprominenter Personen tragen, ohne irgendetwas mit deren Lebensgeschichten zu tun zu haben. Autenrieth, dieser Sohn von zwei Vätern, ist mit einem Geburtsjahr ausgestattet, das auch der Autor sein eigen nennt: 1951. Ein gutes Vierteljahrhundert später ist der Autenrieth Georg aus Franken mittendrin in Berlin-Kreuzberg, im „Übergang von der festen in die, wie wir damals sagten, zweitfeste Wirklichkeit“, wo Leute wie er ihre eigene Coolness genießen, „schwarz, stolz und grundlos selbstverliebt“.
„Apollokalypse“ ist eine Hommage an eine untergegangene Welt, das Berlin der späten siebziger, der achtziger und neunziger Jahre. „Kreuzberg kochte in diesen Tagen ein Süppchen, von dem sich heute weder der Kessel noch auch nur Spuren des Gebräus wiederfinden. Es war ein schwarzes Loch, über dem die bunteste aller möglichen Sonnen explodierte und in dem die Nacht sich durch die Straßen bewegte, wie eine Künstlerin oder eine Kakerlake.“ Die Stadt bot Raum für „außerplanmäßiges Existieren“, hier bevorzugte man „das harte Licht, die scharfe Kante, Begegnungen ohne Ornament“. Am 11. September ist diese Ära im Buch und vielleicht auch in der Wirklichkeit vorbei.
Seinem Ich-Erzähler hat Falkner ein Figurenkarree – zwei Frauen, zwei Männer – gegenübergestellt. Geschult an den amerikanischen Romanen, die er schätzt, hat Falkner lebendige Charaktere aus Fleisch und Blut, mit Begierden, Problemen, Störungen, Konflikten geschaffen. Die Dialoge in diesem Roman klingen glaubwürdig und unausgedacht. Dennoch folgt die Entwicklung dieses Personals kaum den Gesetzen der Psychologie, weil Falkner die Figuren als Archetypen, seinen Roman auch als Porträt einer Generation angelegt hat.
Isabell Kauffmann, Bilijana Stojanow, Heinrich Büttner, Dirk Pruy sind allesamt jünger als der Ich-Erzähler, in den Sechzigern geboren. Den beiden Frauen sind ganze Bücher dieses Romans gewidmet, sie sind die Liebhaberinnen und Lebensgefährtinnen des Erzählers. Die Männer, seine Freunde, sind „Vertreter dieses neuen Typs junger Männer ‚Modell Bundesrepublik‘. Mit Vorsprung auf die Welt gekommen. Söhne, Erben, Luxusausführungen mit Sonderausstattung. Sprösslinge der neuen Herrenrasse, kaum dass die arische sich zerschlagen hatte. Im Kern aber schlaff.“
Der Komplizierteste von allen ist Büttner (unverkennbar von der Figur des Malers Martin Kippenberger inspiriert), ein selbstzerstörerischer, genialischer, dem Wahnsinn verfallender Typ. Büttner war „zwar ein typischer Vertreter der Nutella-Generation, die neben anderen Spezialitäten eben auch einen Prototyp aus Weichling, Erbe und Clown hervorbrachte, der ausschließlich von Fernsehen, Popmusik, Comics und Konsum lebte, aber noch brach der Schimmer einer dunklen Seite die typische Eintönigkeit der Glückskinder und die Gnade der späten Geburt.“
Autenrieth selbst erinnert sich an die Ruinen in der Stadt seiner Kindheit, an die mysteriöse Aufschrift „LSR“ auf den Gebäuden, und manchmal sagt er einen Satz wie: „Der Übergang Friedrichstraße hatte die Ausstrahlung eines Konzentrationslagers.“ Der Zynismus, der in solchen Beschreibungen liegt, folgt der schon 1964 formulierten Einschätzung von Günther Anders, die sich später unter dem Einfluss von Punk in gewissen Milieus durchzusetzen begann: „Die einzige angemessene, die einzige wahre, die einzige der Millionen Entwürdigten würdige Rede ist die zynische.“ Zu diesem Schluss kann man vielleicht nur kommen, wenn man im Schatten von eben erst vergangenen Ereignissen aufwächst, deren Ungeheuerlichkeit sich erst langsam erschließt.
Matrizen, so unpersönlich wie Matratzen
Er verfügt durchaus über Humor, dieser Autenrieth, nur mit Selbstironie hat er’s nicht so. Gut, könnte man sagen, für einen Mann, der eh schon mit zwei Leben geschlagen ist, ist das vielleicht zu viel verlangt. Er weiß immerhin: „Die moderne Literatur hat uns gelehrt, dass wir keinen Anlass haben, einem günstigen Eindruck von uns Glauben zu schenken.“
Sein Erfinder legt an ein paar Stellen ironische Distanz zum eigenen Tun an den Tag. Ahnend, dass gerade die Frauenfiguren ihm doch etwas zu archetypisch geraten sein könnten, lässt er „die Vermieterin“ zu Wort kommen. Sie meint, Autenrieth habe wohl das Unglück gehabt, in seinem Leben „nur diesen matrizenartigen Frauen“ begegnet zu sein. „So unpersönlich wie Luftmatratzen.“
Aber Autenrieth hat größere Probleme. Er muss sich, wie die Väter und Mütter, damit auseinandersetzen, dass es im eigenen Kopf einen verdrängten Anderen geben könnte, der sich Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger nicht nur in den Bars von Kreuzberg herumgetrieben hat, sondern auch an einer Kommandoaktion der RAF beteiligt gewesen ist. Der doppelte Autenrieth steht für zwei Möglichkeiten, zwischen denen diese jungen Leute wählen können: Sich für Thanatos, den bewaffneten Kampf gegen „das System“, oder für den Eros zu entscheiden.
Schließlich kommt im doppelten Autenrieth die Figur der narzisstischen Störung ins Spiel, bei der sich der Jüngling in sein Spiegelbild verliebt und aus einem plötzlich zwei werden. Und dann ist da noch eine letzte Verdoppelung im Gange, die Verdoppelung der Welt durch die Medien, exemplifiziert an der Kommandoaktion der Terroristen, die Falkner mit einer im Fernsehen laufenden Doku über die Morde der Gang von Charles Manson parallelisiert.
Hier zeigt sich einmal mehr die poststrukturalistische Prägung dieses Romans, der nie ohne Rekurs auf die Vergangenheit, wohl aber ohne Politik auskommt. Der Systemgegensatz, der RAF-Terror und seine Unterstützung durch die Stasi, all das wird systemisch betrachtet. Man fühlt sich an Sascha Andersons Denken erinnert, das die politischen Verhältnisse in rein formale, binäre Oppositionen übersetzt, mit denen man spielen kann, wie man will: „Jeder Satellit hat einen Killersatelliten / Jeder Tag hat eine Nacht / Jeder Panzer eine PAK.“ Der postmoderne Künstler kann gleichzeitig staatsfeindlicher Poet und Stasispitzel sein, ohne sich dabei zu widersprechen. Autenrieth ist auch so ein postmoderner Charakter, der vermutlich zu viel Baudrillard gelesen hat: „Ich arbeitete nicht gleichzeitig für beide Seiten. Sondern ich bildete selbst diese beiden Seiten.“
„Apollokalypse“ stellt sich in die Tradition des postmodernen Romans, er ist voller Zitate und Anspielungen an Proust, Ovid und Rilke, und nicht zuletzt Thomas Pynchon: „Die Wahrheit ist niemals nur eine einzige.“ Wenn es gerecht zugeht „auf dera Welt“, dann kommt „Apollokalypse“ auf die Shortlist für den Buchpreis.