Afroitaliener entdecken ihre Geschichte: Die Enkel Giulia de Medicis
Es ist ein mühsamer Prozess voller Hindernisse: Afroitaliener sind dabei, ihre spezifische Geschichte zu entdecken und zu erzählen.
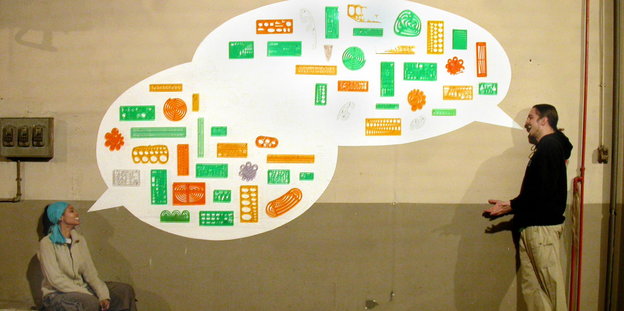
Die Macher von Asmarina: Medhin Paolos (l.) und Alan Maglio Foto: Alan Maglio/Medhin Paolos
„Schau mal da: Da ist Angela Davis, Medhin!“ Medhin Paolos, Mailänder Filmemacher eritreischer Herkunft, braucht ein paar Sekunden, um zu verstehen, dass das jetzt gerade wirklich passiert: Die schon fast sagenumwobene US-Afrofeministin ist nicht nur in Rom, im Viertel Garbatella, sondern sie ist in diesen Märztagen extra hierhergekommen, um Paolos Film zu sehen: „Asmarina“, eine Dokumentation über die eritreische Gemeinde in Mailand.
Für Medhin und sein Team ist es ein bisschen so, als schlösse sich Angela Davis in diesem Moment dem Kampf der afroitalienischen Community an und fordere sie gleichzeitig auf, endlich sichtbarer zu werden. In der Tat ist „Asmarina“ wie ein Mosaikstein in der anstehenden Rekonstruktion der Geschichte der Afroitaliener, speziell der eritreisch-äthiopischen Gemeinschaft, die seit Jahrzehnten in Italien präsent ist und über die doch kaum gesprochen wird.
Der Titel bezieht sich auf einen Kolonialschlager aus den 1930er Jahren, in dem die eritreische Hauptstadt Asmara besungen wird. Was den Film vor allem auszeichnet, ist, dass er überhaupt einmal Protagonisten der afrikanisch-italienischen Geschichte sichtbar macht, mit all ihren Erinnerungen, ihren Bildern und Fotografien.
Ebendies hat man in Italien über Jahrzehnte erfolgreich vermieden. Man spricht nicht gern über das, was im letzten Jahrhundert in Afrika geschehen ist, schon gar nicht über die Brutalitäten des faschistischen Regimes. Somalia, Eritrea, Libyen und Äthiopien waren Italiens „Platz an der Sonne“, den es um jeden noch so abscheulichen Preis zu erobern galt.
Kriegsverbrecher wurden nie belangt
Die Zivilbevölkerung wurde gnadenlos niedergemetzelt, gegen sie wurde entgegen Bestimmungen der Genfer Konvention Senfgas eingesetzt. Folter, Lynchmorde und Vergewaltigung gehörten zum rassistischen System, mit dem die Italiener ihre kolonialen Untertanen regierten. Dieses Apartheidsystem in Libyen und am Horn von Afrika haben die Italiener in Schlagern wie dem berühmt-berüchtigten „Facetta nera“ (Schwarzes Gesichtchen), in zahlreichen Filmen und Büchern gefeiert.
Ein „Nürnberg“ hat es in Italien nach Kriegsende und dem Verlust der Kolonien nie gegeben: Kriegsverbrecher wie die Militärs und Politiker Rodolfo Graziani oder Pietro Badoglio wurden nie belangt. Der Rassismus der italienischen Gesellschaft wurde schön unter den Teppich gekehrt. Dass ein Entkolonialisierungprozess nie in Gang gekommen ist, zeigt sich in aller Deutlichkeit jetzt, da in Zeiten von Massenmigration und Multikulturalismus die alten faschistischen Stereotype die Einwanderer und ihre Kinder treffen; und es sind vor allem die Schwarzen, die darunter zu leiden haben.
Es genügt da schon der Blick auf die TV-Produktion, wo schwarze Männer fast ausschließlich als Dealer oder Kriminelle besetzt werden und schwarze Frauen als private Altenpflegerinnen oder als Prostituierte. Vor allem in der Popkultur findet eine Hypersexualisierung des schwarzen Körpers statt. In Italien kennt jeder den Spot der Firma „Coloreria italiana“, in dem eine Italienerin ihren weißen, unansehnlichen Mann in die Waschmaschine stopft, um ihn dann nach dem Waschgang unter Rap-Begleitung als schwarzes Muskelpaket wieder herauszuziehen: Die unterversorgte Ehefrau, man sieht es ihr an, kann sich kaum halten vor Begierde auf den frisch gefärbten Lover.
Solche Werbespots liefen gleichzeitig mit dem Erwachen der afroitalienischen Community in den 1990er Jahren. Zum Geburtsort wurde eine Endhaltestelle der römischen Nahverkehrsbetriebe: Piazza Mancini in der Nähe des Olympiastadions. Der Platz wurde zum Treffpunkt der jungen Afroitaliener, die vor allem von einem träumten: vom Amerika des Rap, der Black Panther und von Malcom X. Die jungen Leute stammten zumeist aus Labaro im römischen Norden, dem traditionellen Viertel der Eritreer, aber auch aus sogenannten besseren Gegenden.
Kampf um Anerkennung als italienische Bürger
Sie waren Kinder von privaten Altenpflegerinnen, die als Gastarbeiterinnen nach Italien gekommen waren, aber auch Diplomatenkids, die sich in ihren weißen Eliteschulen nicht wohlfühlten und hier einen Zugang suchten zu dem, was gerade angesagt war unter jungen Schwarzen. Nicht alle Anwohner verstanden das oder fanden es gut.
Viele hielten diese schwarzen Jugendlichen schlicht für Kriminelle, auch wenn Drogen auf der Piazza Mancini nie eine große Rolle spielten. Aber die Jugendlichen machten wieder einmal die Erfahrung, dass sie in Italien letztlich rechtlos waren; und mit der gesamten zweiten Einwanderergeneration begannen sie in dieser Zeit den Kampf um Anerkennung als italienische Bürger wie andere auch.
Der Weg zu einem modernen Staatsbürgerrecht ist lang und hart. Das Gesetz lag immer wieder auf Eis, vor allem weil die italienischen Parteien fürchten, die Zustimmung könnte ihnen an der Wahlurne schaden – gerade in Zeiten wie diesen, mit den Attentaten von Paris und Brüssel. Aber wenn das politische Italien auch herumeiert, die Gesellschaft ist so weit, zu sagen: „Italiener ist, wer hier geboren wird und hier aufwächst.“
Am 30. März dieses Jahres gab es eine Anhörung im italienischen Senat unter Beteiligung von Interessentengruppen wie dem Netzwerk „G2 – Die zweite Generation“; und es besteht Hoffnung, dass es nun endlich vorangeht. Die volle Gleichberechtigung der Kinder der Migranten hat starke Unterstützer gefunden, von der Bewegung „L’Italia sonoanch’io“ (Auch ich bin Italien) bis zur Parlamentspräsidentin Laura Boldrini und Exstaatspräsident Giorgio Napolitano.
Eine neue Erzählung etablieren
Die Afroitaliener haben im Kampf um die bürgerlichen Rechte dieselben Interessen wie die anderen Migranten, aber sie haben doch auch noch ein ganz eigenes Anliegen: gegen den Rassismus zu kämpfen, der sie auf spezielle Art trifft; und sie tun das, indem sie eine neue Erzählung zu etablieren suchen. Schriftsteller, Filmemacher und Künstler arbeiten daran, den Blick auf den speziellen und in der Tradition verankerten italienischen Rassismus zu lenken.
Ein Veteran in diesem Kampf ist Jonis Bascir, 1960 geboren, Mutter aus Somalia, Vater Italiener. Er ist einer der produktivsten Schauspieler des italienischen Kinos. „Meine Identität ist Beige“, sagt Bascir. „Die Tatsache, dass sie das Produkt zweier Farben ist, Braun und Rosa-Gelb, hat bei mir das Gefühl verstärkt, dass ich einzigartig bin; und das ist ein Reichtum, den jedes Individuum für sich empfinden könne sollte.“
Das Wort „beige“ nimmt Bascir in seinem Theaterstück BEIGE –L’importanza di essere diverso (Die Wichtigkeit, anders zu sein) auf, wo er mit viel Witz und Ironie all die Diskriminierungen und die Stereotype aufzeigt, die die italienische Identität so komplex machen.
Ähnliches unternimmt Fred Kuwornu, Sohn einer italienischen, jüdischen Mutter und eines Chirurgen aus Ghana. Kuwornu ist viel unterwegs, vor allem in den USA, und sein Projekt „Blaxploitalian: 100 Years of Blackness in The Italian Cinema“ will die Geschichte der schwarzen Präsenz im italienischen Kino erzählen, etwas, was parallel auch auf der Website cinemafrodiscendente.com von Leonardo De Franceschi geschieht.
Spezifisch afrikanische Geschichte
Die Afroitaliener graben ihre Geschichte aus wie Archäologen – und es ist kein Zufall, dass sich dieses Revival gerade jetzt abspielt. Denn für viele ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, eine spezifisch afrikanische Geschichte aus dem hervorzuheben, was bisher nur als Geschichte Italiens zählte und erzählt werden durfte.
Was kaum jemand in Italien weiß: Für diese Aufgabe haben die afroitalienischen Künstler eine Art Maskottchen, das über den neuen schwarzen Protagonismus wacht. Sein Name ist Giulia, Sprössling der weltberühmten Familie Medici. Ihr Vater Alessandrode’ Medici (1510–1537), genannt „Il Moro“ war der Sohn einer afrikanischen Sklavin. In einem Porträt Pontormos sieht man, wie die kleine Giulia die Hand ihrer Verwandten Maria Salviati hält, die sie nach der Ermordung ihres Vaters aufzog.
Das Gemälde, das sich heute im Walters Art Museum von Baltimore befindet, ist die erste bekannte bildliche Darstellung eines afroitalienischen Kindes, wahrscheinlich die erste Darstellung eines Kindes mit afrikanischen Wurzeln in Europa überhaupt. Der Kampf der Afrikastämmigen hat also einen kleinen Schutzengel. Die Beatles würden sagen:„I’ve found a driver and that’s a start.“
Aus dem Italienischen von Ambros Waibel

