Grüne suchen Spitzenkandidaten: Die Überflügelnde
Katrin Göring-Eckardt ist für eine Grünen-Spitzenkandidatur gesetzt. Die Basis entscheidet aber, wie stark sie wird.

Inzwischen mehr als nur eine Reala: Katrin Göring-Eckardt Foto: dpa
ERFURT taz | Katrin Göring-Eckardt sagt „wir“, und das tue sie „bewusst“. „Obwohl ich anderer Meinung war.“ Konkret geht es beim Grünen-Urwahlforum am Sonntagabend in Erfurt um die zweite Asylverschärfung, der auch grün-mitregierte Länder im Bundesrat zugestimmt hatten. Grundsätzlich geht es um den Spirit der kleinsten Oppositionspartei vor ihrer Bundesdelegiertenkonferenz am kommenden Wochenende.
Die Frage lautet für manche: Sind die Grünen eine Partei oder doch eher zwei?
Der Murmeltiertag-Steuerstreit, der Zeitpunkt des Auslaufens von Zulassungen für Diesel- und Benzinautos und dann noch die umstrittene ethische Frage, ob Andersdenkende (konkret: der Daimler-Chef) in Münster sprechen dürfen: Auch einige Spitzen-Grüne fürchten insgeheim, dass ihnen dieser Parteitag in Münster um die Ohren fliegen könnte.
Vier Bewerber treten für die zwei Stellen als Spitzenkandidaten der Partei im Bundestagswahlkampf an: neben Göring-Eckardt Parteichef Cem Özdemir, der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter und Schleswig-Holsteins stellvertretender Ministerpräsident Robert Habeck. In Erfurt ist ihr gemeinsamer Tenor: bitte in Münster keine utopistischen Weltrettungsstatements. Alle Beschlüsse müssen darauf zielen, in einer Regierungsrealität ab Herbst 2017 umgesetzt werden zu können. Egal in welcher der vielen Koalitionskonstellationen, die für Grüne möglich sind, wie die elf mitregierten Länder zeigen. Alle vier sagen immer wieder: Wir wollen regieren. Mit Grün ist auf jeden Fall besser als ohne Grün. Das ist anderswo selbstverständliche Grundlage aller Arbeit, aber hier offenbar immer noch nicht.
Göring-Eckardt organisiert sich eigene Mehrheiten
Während Özdemir, Hofreiter und Habeck einen bis auf Weiteres offenen Kampf um den Männerjob austragen, ist Göring-Eckardt, 50 Jahre, allein auf weiter Flur. Sie hatte bei der ersten Urwahl vor vier Jahren die damaligen Führungsfrauen Roth und Künast geschlagen und abgelöst, was aber eher eine Abwahl war. Danach hatte Göring-Eckardt eine Kampfabstimmung um den Fraktionsvorsitz gegen Kerstin Andreae gewonnen. Seither ist sie in ihrer Geschlechtsklasse konkurrenzlos. Die jetzige Partei-Co-Chefin Simone Peter trat für die Spitzenkandidatur erst gar nicht gegen sie an und hat sich damit darstellungs- und machtpolitisch marginalisiert.
Göring-Eckardt hat die Kandidatur damit sicher. Aber sie hat deshalb nicht automatisch gewonnen, obwohl ihr ein Prozent der Stimmen reicht. Im letzten, krachend verlorenen Wahlkampf hatte sie bei Showmaster Jürgen Trittin nur die Assistentinnenrolle, in der sie sich aber intern neu positionierte. Damit ist es ihr als Erster gelungen, die scheinbare Notwendigkeit einer Flügelzugehörigkeit zu überwinden und eigene Göring-Eckardt-Mehrheiten in der Partei zu gewinnen.
Die Frage ist: Wie stark macht die Basis Göring-Eckardt – oder wie schwach?
Sie geht zu Realatreffen, aber sie immer noch als „Reala“ zu bezeichnen, ist anachronistisch. Sie sagt bewusst „wir“. Sie will draußen angreifen, aber auf keinen Fall innen angegriffen werden. „Superreiche“ mag sie nicht. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ihr „supersympathisch“. Theoretisch. Praktisch will Göring-Eckardt endlich loslegen, um das umzusetzen, was gesellschaftlich und politisch geht.
Führungsrolle oder Mitläuferin?
Die Frage für sie ist, ob ihr durch ein herausragendes Ergebnis diesmal die Führungsrolle zufällt. Und was es bedeuten würde, wenn sie mit einer als mäßig oder gar desaströs interpretierten Prozentzahl aus der Urwahl ginge.
Die Frage für die Parteimitglieder, die laut Eigenwerbung „Boss“ sind und deshalb aus einer Frau auswählen dürfen, lautet also: Wie stark sehen und wie stark machen wir Göring-Eckardt? Und sie lautet daher: Wen stellen wir unter, neben oder über Göring-Eckardt?
In Erfurt war zu erahnen, dass die drei Angebote von Habeck, Hofreiter und Özdemir trotz oberflächlicher Ähnlichkeit sehr unterschiedlich sind. Das betrifft nicht die Frage, mit wem die Grünen koalieren sollten, oder eine einzelne Position zu Energiewende oder Vermögenssteuer. Es betrifft die zentrale Frage, wessen Partei die Grünen sein wollen oder können. Und mit welcher Tonlage, Intellektualität und Emotionalität sie auf die Gesellschaft zugehen.
Regieren als Abstiegsprojekt?
„Vermutlich“, sagte Cem Özdemir, „werden wir 2017 nicht allein regieren.“ Vermutlich nicht, da hat er einen Punkt. Es wird interessant sein, ob in Münster ernsthaft darüber geredet wird, wie die Grünen sich auch mental aufstellen wollen, um den Spagat zwischen ihren großen Zielen und dem täglichen Regieren in der Realität auch auf Bundesebene nicht permanent als Abstiegsprojekt zu spüren.
Es wird ein weiter Weg. Als alle vier die Einladung von Daimler-Chef Dieter Zetsche nach Münster mit dem Hinweis verteidigten, dass eine Mobilitätswende Autokonzerne beinhalte, murrte ein Zuhörer, er registriere hier einen „Autofetisch“. Er selbst hingegen stehe für „solidarischen Nahverkehr“.



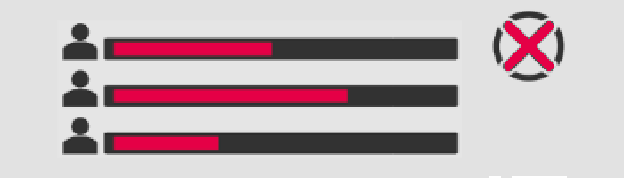



Leser*innenkommentare
jhwh
Eine Spitzenkandidatin, deren Nominierung schon vor der Urwahl feststeht. Hillarious !
mowgli
Zitat: "Alle vier sagen immer wieder: Wir wollen regieren. Mit Grün ist auf jeden Fall besser als ohne Grün. Das ist anderswo selbstverständliche Grundlage aller Arbeit, aber hier offenbar immer noch nicht."
Das verstehe ich gut. Die Frage ist nämlich: WARUM wollen Katrin Göring-Eckardt, Cem Özdemir, Anton Hofreiter und Robert Habeck mitregieren? FÜR WEN ist "mit Grün [...] besser als ohne Grün." Dieses "auf jeden Fall" ist offenbar nicht glaubwürdig. Es gibt wohl menschen, die sich fragen: Wollen die vier Spitzenleute ihre macht nur um des eignen Egos willen, oder wollen sie es um, nun ja, die Welt zu retten?
Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wer ehrlich ist muss zugeben: Das zwei-Grad-Ziel ist kaum noch zu erreichen. Und wenn das mit der Spaltung der Gesellschaft weitergeht wie grade in den USA, in ganz Europa, Australien oder Asien, dann fliegt den Grünen demnächst nicht bloß ihr Parteitag um die Ohren, sondern eine ganze Weltordnung.
Die Welt wie wir sie kennen und schon aus Gewohnheit lieben, kann sich Egoismus an den Spitzen der diversen Organisationen schlicht nicht länger leisten. Das Polster, das in Zeiten des System-Wettbewerbs angelegt wurde, ist mittlerweile aufgebraucht. Es geht ans Eingemachte, auch für die Grünen.
Dass Katrin Göring-Eckardt, Cem Özdemir, Anton Hofreiter und Robert Habeck die Realität bereits in ihrer ganzen Härte und Konsequenz realisiert haben, kann ich mir nicht vorstellen. Ich fürchte, dazu sind sie gar nicht in der Lage. Man ist als Mensch nicht immer Herr im eignen Haus, sagen die Psychologen. Recht haben sie. Es ist bloß bisher keinem etwas Schlaues eingefallen zum Thema Psycho-Sicherheit. Die Atomwaffenarsenale sollten zuletzt 1989 abgebaut werden. Die menschlichen Sprengköpfe hat man bisher nicht einmal im Blick.
Lowandorder
Ja wie? Die Überflügelnde & däh -
"…Er selbst hingegen stehe für „solidarischen Nahverkehr“.
Ja wat denn nu?!
Ja - das ist mal krachend formuliert!
Danke - Herr Peter Unfried.
(Auto - wird ja gern gedehnt zu -
"Ahh - Ohh --- Au - oh!" - & ~>
"Au ---Tor!" klingt nicht unähnlich!;)
kurz - Einfach mal statt von -
"In der Rolle sich intern neu positionieren!" - wa!
Viel Glück dabei!