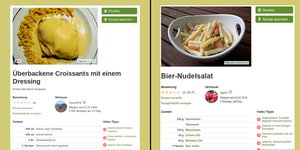Food-Fotografin über ihre Arbeit: „Abdrücken, wenn der Käse zerläuft“
Daniela Haug lichtet Essen im Stil einer Reportage ab. Ein Gespräch über weißen Fisch, bunte Teller und die Vorzüge von rohem Fleisch vor schwarzem Hintergrund.

„Keine Lampen, kein Stativ – Food muss man schnell fotografieren“, sagt Daniela Haug über ihren Ansatz der Food-Fotografie Foto: Daniela Haug
taz.am wochenende: Frau Haug, wie kommt man dazu, Essen zu fotografieren?
Daniela Haug: Manchmal ist es Zufall, manchmal Berufung. Ich bin da reingerutscht. Ich habe eine Reportage über ein Porkcamp fotografiert. Da trafen sich Blogger zum Schlachten und Wursten. Das war der Start. Aber eine richtige Food-Fotografin im klassischen Sinn bin ich nicht.
Warum nicht?
Das ist eines der kompliziertesten Genres innerhalb der Fotografie. Eine Wissenschaft. Da sind Food-Stylisten im Einsatz, da wird gesprüht, gebaut, mit Modellen gearbeitet. Da ist manchmal einiges auf dem Teller gar nicht essbar. Es sind unendlich viele Lampen im Einsatz, um das Essen perfekt ins Licht zu setzen.
Ein enormer Aufwand. Nichts wird dem Zufall überlassen, ähnlich wie in der Modefotografie?
Teilweise sicher, vor allem in der Werbung. Sagen wir, McDonald’s bringt einen neuen Burger in die Läden. Um das perfekte Bild zu bekommen, werden mehrere hundert Hackfleisch-Pattys gebraten. Am Ende geht es dann noch darum, ob die Mayonnaise-Nase rechts herum oder links herum gebogen zu sehen ist …
Sie haben einen anderen Ansatz?
Ich mache das im Stil einer Reportage – mir geht es nicht nur um das Ergebnis auf dem Teller, sondern auch um die Situation in der Küche, die Zutaten, darum, wie ein Essen entsteht.
Also sozusagen eine Farm-to-Table-Fotografie.
Ich bin eine Vertreterin von dem, was gerade stattfindet. Ich fühle mich da Foodbloggern näher, die auch leckere Bilder machen. Aber da ist eben alles natürlich gekocht, nichts gestellt und alles essbar. Es hat nichts Künstliches.
Daniela Haug

Foto: privat
Die Filmproducerin und Fotografin publizierte jüngst das Kochbuch „Open Air“, gemeinsam mit Stevan Paul. Brandstätter Verlag 2016.
Was heißt das konkret?
Keine Lampen, kein Stativ. Food muss man schnell fotografieren, denn es kann ganz schnell nicht mehr gut aussehen. Wenn der Käse zerläuft, muss man sofort abdrücken. Gleichzeitig versuche ich die Schokoladenseite eines Tellers zu finden. Als wenn man einen Menschen porträtieren würde. Mir muss selber das Wasser im Mund zusammenlaufen, damit ich abdrücke.
Ich habe Kochbücher, die nur ein paar Jahre alt sind. Aber die Teller sehen darauf noch viel älter aus. Warum hat Essen auf Fotos so ein geringes Haltbarkeitsdatum?
Ein interessanter Punkt. Unsere Sehgewohnheiten sind ohnehin ständig im Fluss, und ich denke, heutzutage ändern sie sich sogar schneller als früher. Das liegt nicht nur an den Farben auf den Fotos, sondern auch an den Tellern, dem Setting, vor allem an der Art, wie angerichtet wird.
Ich denke dabei an Caprese, also Tomaten mit Mozzarella und Basilikum. Lange Zeit wurden die Zutaten gefächert, alles schöne Halbmonde. Heute liegt die Käsekugel aufgerissen in der Mitte des Tellers.
Gutes Beispiel. Heute liegt der Fokus auf dem Authentischen. Alles soll so real wie möglich aussehen. Ich sehe mir immer wieder an, wie Essen auf den Verpackungen abgebildet wird. Das ist sehr stilisiert. Aber wenn etwas extrem kunstvoll ist, hat man eine Achtung wie vor einem Kunstwerk. Da wird eine Trennung zum Essen aufgebaut. Ich bin überzeugt, das wollen viele Leute nicht mehr. Das ist so wie die Chipstüte im Werbespot, die mit der Schere aufgeschnitten und gebügelt ist. Man sieht einfach, wie künstlich das ist.
Genauso wie bei einem grünen Apfel, einem Golden Delicious?
Ganz genau: Stellen Sie sich einen Bauernapfel vor, vielleicht noch mit einem Blatt dran. Da kann man die Rinde des Baumes spüren und die Wiese, auf der er steht.
Trump oder Clinton? Das ist die große Frage. Aber auch Cannabis wird wichtig – am 8. November, dem Tag der Präsidentenwahl in den USA. In mehreren US-Staaten wird über die Legalisierung von Marihuana abgestimmt. Was das für die Drogenpolitik bedeutet, lesen Sie in der taz.am wochenende vom 5./6. November 2016. Außerdem: Eine Bilanz der Regierung Obama und ein Essay über den US-Wahlkampf. Und: Vor fünf Jahren wurden die Morde des "NSU" bekannt. Bis heute werde die Aufklärung blockiert, sagen die Linke Petra Pau, Opferanwalt Sebastian Scharmer – und Thüringens Verfassungsschutzchef Stephan Kramer im Gespräch.
Mir ist aufgefallen, auf Ihren Fotos sind selten weiße Teller zu sehen.
Ich hasse weiße Teller. Im Alltag ist er zwar praktisch, aber auf dem Foto ist er mir zu langweilig, zu steril. Wenn man mit Tageslicht fotografiert, dann eignet der sich gar nicht. Weiße Teller haben was von höherer Cuisine. Mit anderen Tellern, auch handwerklich hergestellten, das hat eben auch was Natürlicheres, etwas Archaisches.
Ich frage mich, ob Fotografie auch unsere Essgewohnheit beeinflusst. Der Nudelauflauf oder ein englischer Pie sind heute aus der Mode, vielleicht auch, weil sich die Zutaten im Gericht verstecken?
Interessante Interpretation. Es stimmt: Dass die Zutaten sichtbar sind, ist bei vielen Gerichten schon sehr wichtig. Bei bestimmten Gerichten wird das dann richtig tricky.
Zum Beispiel?
Weißer Fisch ist schwer zu fotografieren. Da lässt man am besten die Haut dran. Oder auch Suppen und Eintöpfe. Der Leser soll ja sehen, was sich unter der Oberfläche verbirgt.
Geben Sie zu, da haben Sie auch Tricks.
Man schöpft ganz viel von der Einlage in den Teller und gießt nur etwas Suppe drüber. Dann schaut einiges oben raus.
Rohes Fleisch sieht man nicht oft auf Fotos.
Das stimmt, aber ist Ihnen aufgefallen, dass rohe Steaks heute oft vor schwarzem Hintergrund stehen? Das bringt das Rot zum Leuchten. Fleisch muss kraftvoll aussehen.
Was halten Sie davon, dass so viele Menschen ihr Essen fotografieren und wie Selfies ins Netz stellen?
Es hat sich was verändert im Umgang mit Essen, es gibt eine große Emotionalisierung. Kann sein, dass es auch an der digitalisierten Welt liegt und wir im Alltag in den Büros immer weniger Umgang haben mit natürlichen Dingen. Deswegen sind auch solche Sportarten, die in die Natur führen, wie Wandern und Radfahren, immer beliebter. Ich glaube, es gibt da eine große Sehnsucht. Und Essen ist vielleicht der einfachste Zugang zur Natur.
Ich komme selten auf die Idee, mein Essen im Alltag zu fotografieren. Mir käme es vor, als wollte man den Genuss konservieren.
Ich gebe Ihnen recht. Viele Dinge haben in ihrer Vergänglichkeit ihre Schönheit. Das gilt ganz besonders für das Essen.